Alphabet der Heimatkunde

Wissenschaft trifft auf Volksglaube
| Startseite | Graphiken | Kaleidoskop | Touristisches |
|
|
Heimatkunde |
|
Vor ungefähr 120 Jahren dampfte an einem schönen Frühsommertag der aus Köln kommende Personenzug durch den frühen Morgen in Richtung Aachen. Draußen zog die weiträumige Landschaft der Kölner Tieflandbucht mit ihren großen, fruchtbaren Äckern vorbei. Die Bauern hatten ihr Tagwerk bereits begonnen und waren mit ihren Fuhrwerken auf dem Weg zur Feldarbeit.

Foto: Video-Produktion Karl Irle.
Auf den Holzbänken der dritten Wagenklasse saß ein junger Mann, der die vorbeiziehende Landschaft aufmerksam betrachtete. Der mit wetterfester Kleidung, festem Schuhwerk und großem Rucksack ausgerüstete junge Mann war kurz bei Bonn in unmittelbarer Nähe des Rheins aufgewachsen. Bereits in frühen Kindertagen war ihm die schier unendliche Vielfalt der unterschiedlichsten Steine aufgefallen, die der Strom zu rundlichen, ovalen, meist glatten Gebilden abgerollt und an seinen Ufern deponiert hatte. Oft hatte er als Kind besonders augenfällige Steine spielerisch angeklopft, weil Struktur und Farbe ihn neugierig machten. Das war auch der Grund dafür, dass er von seinen Freunden Josef Steinklopfer genannt wurde.
Manchmal und mit viel Glück ließen sich auch Kieselsteine finden, die das Licht durchschimmern ließen, wenn man sie gegen die Sonne hielt. Im trockenen Zustand wurde ihre Oberfläche rauh und milchig, aber manche von ihnen waren innen wasserklar. Diese konnte der ortsansässige Juwelier zu prächtigen, glitzernden Schmucksteinen verschleifen lassen, die bezüglich Form, Farbe und Glanz ganz stark an Brillanten erinnerten. Dem kleinen Josef war dies damals wie ein Wunder vorgekommen. Und wenn die Steine von der Schleiferei zurückkamen, fiel, je nach Menge und Güte der vorher abgelieferten Rohsteine, für Josef immer ein gutes, oft ein sogar beträchtliches Taschengeld ab. Einmal, nach einer außergewöhnlich ergiebigen Rücksendung hatte er zusätzlich zu einer guten Bezahlung auch noch einen der schönsten geschliffenen Steine geschenkt bekommen und sich darüber riesig gefreut. Dieser Stein befand sich immer noch wohlbehütet in seinem Besitz.

Geschliffener Rheinkiesel,
Foto: Werbestudio Toporowsky.
Rheinromantik und Rheintourismus standen damals hoch in Mode und Reisende aus allen Teilen Deutschlands sowie insbesondere auch aus England ließen sich von der großartigen Rheinlandschaft verzaubern und kamen zur Sommerzeit häufig durch den Ort. Ein Andenken in Form eines echten Rheinkiesels, wie diese Steine genannt wurden, war bei vielen Reisenden nicht nur hochwillkommen, sondern ausgesprochen begehrt und gesucht.
Mittlerweile wusste Josef natürlich, dass diese Art Steine nichts anderes als Bergkristalle aus den Alpen waren. Zusammen mit den Muttergesteinen waren sie durch Verwitterung vom Gebirgskörper losgelöst worden und irgendwann in einen der unzähligen Wildbäche gelangt. Von hier aus hatten sie dann ihre lange Reise angetreten und waren bei jedem Hochwasser ein kleines Stückchen weitertransportiert worden, wobei sie bei jedem unsanften Zusammenstoß mit anderen Gesteinsbrocken einen Teil ihrer scharfkantigen Gestalt verloren.
Das Wissen um Entstehung und Herkunft hatte den Zauber, den die Steine auf Josef ausübten, nicht gebrochen. Sicherlich war das Geheimnisvolle gewichen, aber die makellose, edle Reinheit konnte ihn immer noch faszinieren, ebenso wie die Vorstellung, dass der Kristall in dunkelster Tiefe des Alpenmassivs entstanden war, dass gewaltige Zeiträume vergehen mussten bis er ans Licht kam und unzählige Jahre des Transports vonnöten gewesen waren bis ausgerechnet er, Josef, ihn finden durfte. Oft noch dachte er daran zurück, wie er als kleiner Junge die geschliffenen Steine mit ungläubigem Staunen betrachtet hatte.
Etliche Jahre später hatte er im Gymnasium erfahren, dass es eine junge, aufstrebende Wissenschaft gab, die sich mit der Herkunft der Steine und mit der Entwicklungsgeschichte der Erdkruste ganz allgemein befasste. Damals bereits hatte er sich vorgenommen, dieses Fach einmal zu studieren. Entsprechend seines Vorsatzes hatte er nach dem Abitur angefangen, Geognostik - heute würde man Geologie dazu sagen - zu studieren. Während dieser Zeit war Josef Steinklopfer allerdings zunehmend zum Bücherwurm geworden und hatte neben den Vorlesungen alles an Fachliteratur verschlungen, dessen er habhaft werden konnte.
Exkursionspläne
Nach der langen Studienzeit war Josef jetzt gerade dabei, sein Bücherwurmdasein gründlich zu verändern und viele Dinge, die er erlernt, von denen er gehört hatte, mit eigenen Augen anzuschauen. Deshalb war er in Köln in den Zug gestiegen, den er kurz hinter Düren, in Langerwehe, dem Startpunkt seiner Tour, wieder verlassen wollte.
Kurz vor Düren wurde das gleichmäßige, rhythmische Rattern des Zuges von der Stimme des Schaffners "Guten Morgen, die Billetts bitte" übertönt. Der Schaffner hatte den Waggon zwecks Fahrscheinkontrolle über den offenen Verbindungssteg betreten, der jeweils zwei zusammengekoppelte Zugwagen miteinander verband und Perron genannt wurde. Seine eindrucksvolle Uniform mit goldenen Knöpfen und silbrig glänzenden Ketten für Dienstuhr und Trillerpfeife sowie seine gleichermaßen eindrucksvolle Umhängetasche mit aufgeschnallter, rot-grüner Signalkelle verliehen dem Schaffner das Aussehen eines preußischen Beamten. In Wirklichkeit aber war er ein leutseliger Rheinländer, der nach langjährigem Dienst auf dieser Strecke die meisten Fahrgäste zumindest von Ansehen her kannte. Dies galt insbesondere für den Frühzug, der ganz überwiegend und regelmäßig von den gleichen Leuten benutzt wurde: von Arbeitern, die zur Arbeit fuhren; von Bauersfrauen, die zum Wochenmarkt wollten oder von Älteren und Kranken, die in die Stadt zum Arzt mussten.
Daher und auch wegen der etwas ungewöhnlichen Ausrüstung des Fahrgastes stutzte der Schaffner, als Josef ihm seinen Fahrschein entgegenhielt.
"Die meisten Fahrgäste sehe ich regelmäßig hier im Zug; aber Sie scheinen ja ganz neu hier zu sein."
"Ganz richtig, ich fahre diese Strecke zum ersten Mal."
"Ihr Billett ist bis Langerwehe ausgestellt, sicherlich sind Sie ein Töpfergeselle, der sich bei den Keramikern umsehen möchte."
"Nein, nein, ich habe mir Langerwehe als Ausgangspunkt für eine Wandertour ausgesucht."
"Na so was, Langerwehe ist als Wandergebiet und Sommerfrische ja nicht gerade berühmt."
"Ich weiß wohl; aber ich möchte mir den Braunkohleabbau kurz vor Lucherberg ansehen. Dort sollen in der Braunkohle noch ganze Baumstämme und Farnwedel zu erkennen sein."
"Das mag wohl sein, die Gruben sind übrigens vom Zug aus schon zu sehen."
"Anschließend muss ich dann sehen, dass ich nach Gressenich oder Mausbach komme. Mit der Betriebsleitung der Erzgrube Diepenlinchen habe ich für Morgen einen Besichtigungstermin vereinbart. Und stellen Sie sich vor, ich kann sogar bis auf über 250 Meter Tiefe in die Grube einfahren."
"Da haben Sie sich ja einiges vorgenommen. Und soll es anschließend auch noch weitergehen?"
"Na klar, wenn ich schon einmal in der Gegend bin, schaue ich mir Übermorgen auch die Zinkhütten in Stolberg an. Die Stolberger haben ein ganz neues, modernes Verfahren zum Rösten der Erze entwickelt."
"Rösten kenne ich nur bei Kastanien, Brot oder Kartoffeln."
"Ja sicher, bei den Erzen ist das ganz ähnlich. Jedenfalls braucht man auch hierfür große Hitze."
"Aber essen kann man sie hinterher doch sicherlich nicht."
"Sehr richtig, essen kann man sie nicht; aber in geröstetem Zustand lassen sie sich verhütten. Und das ist es ja, worauf es bei Erzen ankommt."
"Ja, ja, was Industrie und Arbeitsplätze angeht, ist in Stolberg und auch in Eschweiler richtig was los. Neulich erst sprach man wieder davon, dass die Steinkohlegrube Centrum noch Leute sucht. Verdammt harte Arbeit, aber auch verdammt guter Lohn, wie man hört."
Besagte Grube Centrum lag im sogenannten Eschweiler Kohlberg zwischen Stolberg und Eschweiler und war damals das bedeutendste, in Privatbesitz befindliche Steinkohlenbergwerk Deutschlands. Zeitweilig arbeiteten hier über 1300 Leute. Natürlich kannte Josef diese Grube auch, und er erzählte dem Schaffner, dass er dort ebenfalls einen Besichtigungstermin vereinbart hatte und dass er Anfang nächster Woche von dort aus wieder nach Köln zurückfahren würde.
Mit einem freundlichen, herzlichen Lächeln und Kopfnicken meinte der Schaffner: "Nun ja, dann wünsche ich viel Spaß und guten Erfolg. Könnte sein, dass wir uns auf der Rückfahrt wieder begegnen". Damit fuhr er mit seiner Fahrkartenkontrolle fort: "Die Billetts bitte... die Billetts bitte..."
Entsprechend seines Planes machte sich Josef Steinklopfer nach seiner Ankunft in Langerwehe auf den Weg zu den Braunkohlefeldern kurz vor Lucherberg. Schnell hatte er sich hier mit der Belegschaft vor Ort angefreundet, und die Leute zeigten sich ausgesprochen erfreut über den jungen Fremden, der sich für ihre Arbeit so sehr interessierte. Gerne zeigten sie ihm die Stellen, wo große, fast noch gänzlich erhaltene Baumstämme zu erkennen waren. Obschon sie beim Herausnehmen sofort zu zerbröseln begannen, war die faserige Holzstruktur noch gut sichtbar. An einigen Stellen waren in den Braunkohleschichten eine Art von Pinienzapfen eingeschlossen, deren Substanz ebenfalls zu Braunkohle umgesetzt war. Wie Josef früher einmal gehört hatte, war der Mechanismus zum Öffnen dieser Zapfen immer noch intakt, obschon sie einige Millionen Jahre alt waren. Daher sammelte er ein gutes Dutzend schön erhaltener Exemplare auf, weil er sie später zuhause vorsichtig trocknen und dabei beobachten wollte, wie sich die Schuppen langsam öffnen würden.

Pinienzapfen aus der Braunkohle,
Foto: Klaus Heymann.
In der Braunkohlegrube war für Josef so viel zu sehen gewesen, dass er sich bereits verspätet hatte. Nun musste er zusehen, dass er heute noch Gressenich oder Mausbach erreichte. In Langerwehe hatte er sich am späten Nachmittag nach dem Weg erkundigt, und, da er sich sputen musste, nahm er die Abkürzung an der alten Kirche vorbei über den Höhenrücken nach Heistern.
Kurz hinter dem Aufstieg fiel ihm rechts des Weges eine Sandgrube auf, aus der feinkörniger, weißer Sand gefördert wurde. Zu beiden Seiten der Abbaukante war die Sandlagerstätte durch steile, fast senkrecht stehende Felswände begrenzt. Seiner Meinung nach handelte es sich um eine größere Felsspalte, die vor einigen Hunderttausend oder Millionen Jahren von einem Fluss oder einem Meeresarm zugeschwemmt worden war. Gerne hätte er sich noch einen Überblick über die Längenausdehnung der Sandablagerung verschafft, aber die Zeit drängte. Und vielleicht ergab sich ja im Laufe des Abends Gelegenheit, hierüber durch Nachfragen noch etwas zu erfahren.

Sandgrube zwischen Langerwehe und Heistern,
Foto: F. Holtz
Ohne weitere Verzögerung war Josef dann über Heistern und Hamich nach Gressenich gelangt. Da es bei seiner Ankunft in Gressenich bereits zu dunkeln begann, hatte Josef Steinklopfer im Dorfgasthof "zum Pannes" um Quartier nachgesucht, dort ein einfaches Zimmer bezogen und ein schmackhaftes Abendessen eingenommen. Jetzt stand er am Tresen und wollte mit einem frischen Bier aus der zum Gasthaus gehörenden Brauerei den Tag ausklingen lassen. Beim Zapfen des schäumenden Bieres sprach der Wirt ihn an: "Ich hoffe, Sie sind mit Ihrem Zimmer zufrieden und das Abendessen hat Ihnen geschmeckt."
"Oh ja, vielen Dank; nach dem langen Tag und der weiten Wanderung war das Abendessen ganz vorzüglich. Wie sagt man doch so schön: Hunger ist der beste Koch."
"Ja, ja, aber ich denke, auch morgen wird es Ihnen bei uns schmecken, selbst wenn der Hunger nicht ganz so groß ist."
"Auf meinem Weg von Langerwehe hierher bin ich an einer großen Sandgrube vorbeigekommen."
"Dann haben Sie sicher den Höhenweg über Heistern genommen."
"Dann scheinen Sie die Sandgrube ja zu kennen. Vielleicht wissen Sie auch, wie lange dort schon nach Sand gebuddelt wird und wie weit sich das Abbaufeld hinzieht."
"Soweit ich weiß, hat man dort schon immer Sand geholt. Wenn ein Bauer eine Fuhre Sand brauchte, fuhr er einfach dorthin und schaufelte seine Schlagkarre voll. Vor einiger Zeit aber hat einer angefangen, den Sand von dort zu verkaufen und mit seinem Fuhrwerk zu den Baustellen zu fahren. Das Geschäft scheint ganz gut zu laufen. So hat die Flutwelle letztlich doch noch etwas Gutes bewirkt, auch wenn sie Gression fortgeschwemmt hat."
"Jetzt aber mal etwas langsamer; was hat der Sand mit einer Flutwelle zu tun, und was bitteschön ist denn eigentlich Gression?"
"Ein bisschen was könnte ich Ihnen auch darüber erzählen, aber der Heinrich Hoffmann dahinten weiß noch viel besser Bescheid. Der hat auch begonnen, die alten Geschichten zu sammeln, in denen von Gression, von Hexen, von Zwergen und von sonst noch mancherlei absonderlichen Dingen berichtet wird. Neulich noch hat er gemeint, er wolle ein Buch mit diesen Geschichten drucken lassen. Es scheint ganz so, als wolle er den Gebrüdern Grimm Konkurrenz machen."
Mit einem kurzen Blick zu einem der Tische im Schankraum rief der Wirt: "Hä Hein, kannste änns erövver komme, he well änne jet övver Gression wesse."
"Benn at ongerwähs", antwortete ein stattlicher, älterer Herr mit bereits leicht angegrautem Haar, der sich von seinem Platz erhob und mit freundlichem Lächeln auf Josef zukam.
"Wat äss da los Jong, wat haste dann besher at all van Gression jehoot?"
"Eigentlich nur, dass es irgendwas mit der Sandgrube zu tun hat, aber kapiert habe ich bisher nichts."
"Das glaub ich gern, ist ja auch nicht ganz so einfach. Die Geschichte von Gression ist uralt, und in jedem Dorf wird sie ein bisschen anders erzählt. Denn unsere Groß- und Urgroßeltern haben sie immer mit Einzelheiten aus ihrem Dorf ausgeschmückt. Wenn man diese Einzelheiten zusammenfasst, lässt sich die Sage wie folgt erzählen." Wenn Hoffmann auch die Bruchstücke der Sage zusammenfasste, so erzählte er die Geschichten genau so, wie er sie von den älteren Leuten hunderte Male gehört hatte. Es waren alles ganz kurze, einfache Geschehnisberichte, welche die Leute ohne Umschweife, ohne Ausschmückung erzählten. Und dieser Erzählstil ist ganz typisch für alle Sagen, wenn sie in ihrer alten, ursprünglichen Form wiedergegeben werden.
"Gression war vor Zeiten eine gewaltig große Stadt. Gressenich war ihr Mittelpunkt. Von hier zog sie sich nach Westen bis Cornelimünster in einer langen Straße. In entgegengesetzter Richtung ging sie der Münsterstraße entlang auf Düren hin, das auch noch zur Stadt gehörte. Nach Norden erstreckte sie sich weithin über Jülich. Damals wurde in Gressenich viel gebergt. Man grub nach allerlei Erzen, besonders Blei-, Eisen- und Kupfererzen. Das bedeutendste Bleibergwerk war im Schieverling zwischen Gressenich und Diepenlinchen. Viele setzten den Bergwerksbetrieb in die Zeit der Römer, andere noch früher, in die Zeit der Sündflut. In den Bergwerken arbeiteten ganz kleine Menschen. Es sollen Römer gewesen sein, und alte Leute nannten deshalb früher Menschen von ungewöhnlich kleinem Wuchse Römermännchen. Durch den großen Erzreichtum in den Bergwerken soll großer Reichtum in die Stadt geflossen sein. Der Reichtum verleitete die Bewohner zu Üppigkeit und Völlerei. Allerlei Laster nahmen überhand, bis endlich der Zorn Gottes über sie kam. Eine gewaltige Flut, die manche als die Sündflut annehmen, schwemmte alles hinweg und begrub das Bergwerk unter dem Sande. Von den Gebäuden der Stadt blieben nur noch Trümmer übrig, die in geringen Resten an manchen Stellen sich in den Äckern finden."
 Foto: F. Holtz |
Römische Fundamentreste (hier der Tempelbezirk Varnenum) sollen der Sage nach Überbleibsel der Stadt Gression sein. |
"Und diese Flutwelle soll, wenn ich Sie richtig verstehe, den Sand zwischen Langerwehe und Heistern hinterlassen haben.";
"Das ist das, was die Leute glauben."
"Ich hatte leider kaum Zeit, näher hinzusehen, aber es schien mir eine ganz normale Sandablagerung zu sein."
"Allzu wörtlich sollten Sie diese Geschichten nicht nehmen. Als man dort irgendwann Sand gefunden hatte, fiel den Leuten natürlich sofort die Flutwelle von Gression ein. Siehste, hieß es dann, bis hier her ist das Land damals beim Untergang von Gression überschwemmt gewesen. Ganz ähnlich ist es sich mit den Muscheln, die man gelegentlich in den umliegenden Kalksteinbrüchen finden kann. Auch hiervon wird behauptet, es seien Überreste der Flut, die Gression fortgerissen habe."
"Fossilien kann man hier also auch finden. Ich hätte doch mehr Zeit einplanen sollen, das nämlich würde ich mir auch noch ganz gerne angesehen haben."
Wissenschaft trifft auf Volksglaube
"Dort drüben", setzte Hoffmann die Unterhaltung fort, "der junge Bursche in dem grünen Wams, der Hubert, arbeitet im Steinbruch gleich hier um die Ecke. Meist hat er ein schönes Exemplar dieser Muscheln in seiner Hosentasche, als Talismann sozusagen." Mit einem lauten "Hubbäät!" wandte Hoffmann sich dem jungen Mann am anderen Ende des Tresens zu: "Häste och hüh wärrem ding Moschel dobäj?"
"Jah joo, dat äs doch minge Jlöcksbränger."
"Kannste se dann änns kicke losse?"
Während der angesprochene junge Mann mit den Worten: "Ich komm erövver, ich bräng mich märr jau noch e Bier met" etwas schwerfällig zu den beiden hinüber schlenderte, griff er in eine seiner ausgebeulten Hosentaschen und präsentierte - nicht ohne Stolz - auf seinem ausgestreckten und schwieligen Handteller wortlos sein schönstes Muschelexemplar, das er bei seiner jahrelanger Steinbrucharbeit gefunden hatte.

|
Brachiopode
aus den Stolberger Kalksteinzügen. Sammlung und Foto: F. Holtz. |
"Au ja" meinte Josef, "ein wunderschöner Brachiopode aus dem Devon-Meer."
"Irrtum junger Mann, nicht aus dem Meer, aus dem Steinbruch gleich nebenan."
"Ja ja, aber dort, wo heute der Steinbruch ist, war vor langer, langer Zeit einmal Meer."
"Das kann nicht sein, das hätte mein Großvater mir bestimmt erzählt. Der wusste nämlich Bescheid was hier alles passiert ist, auch wenn es Gott-weiß-wie-lange her gewesen ist."
"Das konnte Ihr Großvater nun wirklich nicht wissen."
Eine große, gewaltige Flutwelle, von der nicht nur sein Großvater, sondern auch die anderen alten Leute alle keine Ahnung gehabt haben sollten, konnte Hubert sich ja noch vorstellen. Aber die Idee, sein Steinbruch wäre einmal Meer gewesen, schien ihm so absurd, kam ihm eigentlich sogar so dämlich vor, dass er diese Möglichkeit überhaupt erst gar nicht in Erwägung ziehen wollte. Schlimmer aber und für Hubert nahezu ungeheuerlich war, dass die Autorität seines Großvaters, der für ihn Inbegriff und Sinnbild für Erfahrung, Sachverstand sowie Kompetenz gewesen war, von einem hergelaufenen Fremden in Zweifel gezogen wurde. Dabei hatte der Fremde seinen Großvater nie gekannt. Seine ganze Überzeugung und auch seine Entrüstung brachte Hubert mit den Worten zum Ausdruck:
"Mein Großvater wusste immer alles".
"Ihr Großvater konnte das deshalb nicht wissen, weil damals, als hier Meer war, noch keine Menschen lebten."
"Nehmen wir mal an, hier wäre Meer gewesen, dann konnten hier ja auch keine Menschen leben."
"Damals gab es noch keine Menschen, die Menschen waren noch gar nicht entstanden."
"Also vor Adam und Eva."
"So könnte man sagen."
"Also keine Menschen; aber vielleicht ein paar Eingeborene."
"Nein, auch keine Eingeborenen. Schon deshalb nicht, weil Eingeborene auch Menschen sind."
"Dann hat aber auch kein Mensch dieses Meer gesehen."
"Richtig, es war ja auch niemand da."
"Keiner da - und keiner gesehen???"
"So ist es."
"Du bäss änne Luhse, wää well Dich ävver dann van dat Meer, datt känne jesee hat, verzallt haan!!! Nee nee, do wor kee Meer, die Moschel es van die Övverschwemmung, die Gression zerstührt hat."
 |
 |
| Brachiopode im Muttergestein Sammlung und Fotos: F. Holtz |
|
"Überhaupt keine Frage", mischte sich Heinrich Hoffmann beschwichtigend ein, "die Leute glauben immer noch fest daran, dass hier früher einmal Gression gestanden hat!"
"Ist ja auch eine schöne Geschichte;" grübelte Josef, "die Frage ist nur, was davon stimmt. Die angeblichen Beweise, die ich bisher gehört habe, klangen für mich jedenfalls wenig überzeugend."
"Nun ja," fuhr Hoffmann fort, "was Sie bisher gehört haben, beweist eigentlich nur, dass die uralte Sage immer noch lebt, dass die Leute sich auch heute noch damit auseinandersetzen.
Über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten können wir uns auch gerne unterhalten; nur die schlüssigen Beweise, die Sie vielleicht erwarten, werden Sie kaum finden. In jedem Fall aber wird man akzeptieren müssen, dass diese Geschichten irgendwann entstanden sind. Über die Hintergründe lässt sich meist nur spekulieren.
Aber was ich noch sagen wollte ist, dass die Braunkohle hinter Langerwehe vom Volk auch als Treibholz gedeutet wird, welches die Flutwelle von Gression hinterlassen hat. Manche behaupten auch, der Flutwelle wäre eine Brandkatastrophe vorangegangen, da die meisten Baumstämme verkohlt seien."
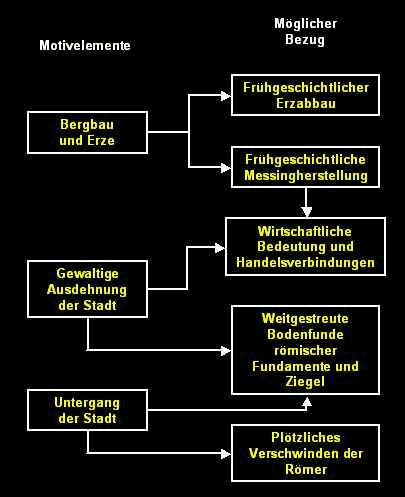
Die Sagenstadt Gression (Überblick),
Skizze: F. Holtz
"Die Braunkohle ist aber nun wirklich und zweifelsfrei eine natürliche Lagerung früherer Sumpfwälder." warf Josef ein.
"Jah, jlöhvste et dann," fuhr Hubert ihm ins Wort, "fängt dä at wärrem domet aan. Ömm Lucherberch orömm ess noch nie Bösch jewäh, do wöhr och derr Bohm völl ze schahd vöör. Do worre alle-ze-Lähve merr Välder."
"Ihr braucht Euch überhaupt nicht aufzuregen;" besänftigte Hoffmann die erhitzten Gemüter, "die Sache mit der Braunkohle, mit den Muscheln und auch mit den Sandmassen ist schließlich in keinster Weise eine Kernaussage dieser Geschichte, sondern eher schmückendes Beiwerk.
Die Kernaussage besteht eigentlich nur darin, dass es hier vor langer Zeit eine Bergbaustadt gegeben haben soll, die irgendwann, aus welchen Gründen und auf welche Art auch immer, verschwunden ist. Was passiert sein soll, weiß man nicht so genau. Manche Leute behaupten, nicht die Flutwelle, sondern Kriegshorden hätten die Stadt zerstört. Und andere erzählen, Gression wäre vom Erdboden verschluckt worden. Einige Leute wollen sogar schon an hohen Feiertagen Glockengeläut tief aus dem Erdinneren gehört haben."
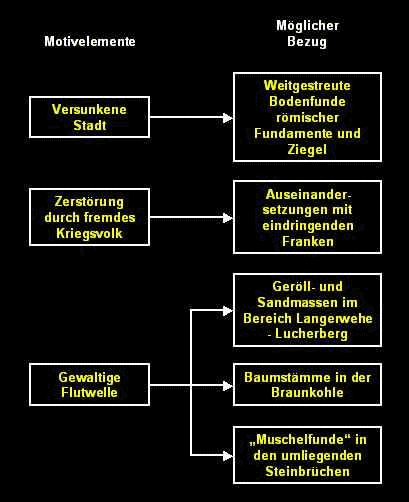
Untergang der Sagenstadt Gression,
Skizze: F. Holtz
Was Heinrich Hoffmann nicht wissen konnte war, dass einige Jahrzehnte später ein gewisser Peter Bündgens ein Gedicht über die Glocken von Gression schreiben würde. Hierin wird geschildert, wie ein Bauer zur nächtlichen Christmette unterwegs ist, sich auf einen Stein setzt und eine Verschnaufpause einlegt. Hier hört er aus der Tiefe herauf die Glocken von Gression, die zum Festtag gebeiert werden. Unter Beiern verstand man damals eine bestimmte Technik des Läutens, bei dem der Klöppel der Glocke mit der Hand rhythmisch gegen die Glockenwandung geschlagen wurde. In dem Gedicht heißt es:
Schneebedeckt, in Pelz und
Mantel,
Ruht er aus auf einem Steine,
Denn im Kopfe ist's ihm schaurig,
Und ermüdet sind die Beine.
Träumend schweifen
die Gedanken
Nach der Stadt, - nach Gressione,-
Die hier früher hat gestanden,
Aller Städte Stolz und Krone.
An sein Ohr
ertönen plötzlich
Festtagsklänge – Glockenläuten,
Aus der Tiefe dringt das Klingen,
aus der Erde will's ihm deuten.
Gloria in exelsis Deo!
Hört er aus dem Boden schallen,
Und ihm dünkt, als säh er Menschen
Fromm zum alten Dome wallen.
Großer Gott, die
Weihnachtsstunde!
Himmel höre! Das ist beiern!
Hier will man in dunkler Tiefe
Wahrlich Gottes Ankunft feiern!
"Im Prinzip," so setzte Hoffmann seine Erklärungen bezüglich Gression fort, "suchen wir eigentlich nur eine Bergbaustadt, die irgendwann einmal aufgehört hat zu existieren.
Nun sind aber in den letzten Jahren einige Bodenfunde gemacht worden, die römischen Bergbau in unserer Gegend belegen. Siedlungsreste in Form von Fundamenten, Dachziegeln, römischen Keramikscherben und römischen Münzen sind hier bei uns schon fast an der Tagesordnung. Außerdem ist auch die Tatsache bestens bekannt, dass die Römer im 4. Jahrhundert aus unserer Gegend verschwunden sind.
Man kann also kaum ernsthaft bezweifeln, dass die Sagen um Gression sich auf den Erzabbau beziehen, der zur Zeit der Römer hier bei uns stattgefunden hat. Und von dem sagenhaften Reichtum wird bestimmt nur deshalb erzählt, weil sich da, wo man Bodenschätze findet, eigentlich immer ein gewisser Wohlstand einstellt."
Wie wir heute wissen, hat Heinrich Hoffmann mit dieser Bemerkung sicherlich untertrieben. Es gibt mittlerweile viele gute Gründe, die darauf hinweisen, dass die Römer unser hiesiges Galmeierz zur Messingherstellung genutzt haben. Und der Werkstoff Messing war damals außerordentlich begehrt und kostbar. Der in der Sage anklingende Reichtum kann also durchaus einen realen Hintergrund gehabt haben.
Der von Hoffmann gegebene Hinweis auf die Römerzeit veranlasste Hubert zu der Bemerkung: "Klar war Gression eine Römerstadt, schließlich hießen die Zwerge, die da gearbeitet haben, ja auch Römermännchen."
"Wie, was," wunderte sich Josef, "Zwerge habt Ihr hier auch gehabt?"
"Sicherlich wollen Sie mir jetzt verklickern, dass die Zwerge und Heinzelmännchen auch aus dem Meer kommen."
"Ganz und gar nicht. Mir fällt nur gerade ein, dass die Germanisten und Volkskundler immer häufiger darüber nachdenken, ob mit den Heinzelmännchen nicht vielleicht römische Penaten gemeint sein könnten."
"Römische Penaten! Watt äss datt dann, Penaten känn ich märr vöör Kengervöttcher."
"Ja ja, aber ursprünglich waren die Penaten kleine römische Hausgeister, die Hof und Herd bewachen und vor Unheil schützen sollten. Daraus sind dann wohl später die Heinzelmännchen entstanden, die sich im Haus auf vielerlei Art nützlich machten."
"Unsere Zwerge haben aber auch im Bergbau gearbeitet."
"Ist ja interessant. Erzählen Sie doch mal so eine Geschichte."
"Warum nicht?" erklärte Hubert sich bereit und begann mit einer kurzen Geschichte, die er schon als Kind oft gehört hatte: "Im Römerfelde und auch im Schieverling, sollen uralte Bergwerke bestanden haben. In diesen Bergwerken sollen Bergleute von kleinem Schlage gearbeitet haben. Man glaubt, es seien Römer gewesen. Deshalb bezeichneten die früheren alten Leute von Gressenich Menschen von ungewöhnlich kleinem Wuchs mit dem Namen Römermännchen oder auch Quärrismännchen. Man berichtet sogar, dass solche kleinen Männchen, die man für Nachkommen der alten Bergleute hielt, hier in der Gegend bis in die jüngste Zeit gelebt hätten."
In der Geschichte, die Hubert soeben erzählt hatte, wird ein weiteres, allgemein gültiges Merkmal der Sage deutlich. Im Gegensatz zum Märchen nämlich werden in den Sagen häufig konkrete Ortsangaben gemacht, so wie das hier mit den Flurbezeichnungen Römerfeld und Schieverling der Fall ist.
"Also Quärrismännchen werden die Wichtel bei Euch genannt," nahm Josef nach kurzem Überlegen das Gespräch wieder auf. "dieser Ausdruck stammt bestimmt von dem uralten Wort Querge, was so viel wie Zwerge bedeutet."
"Wir wissen sogar," prahlte Hubert, "wo die Quärrismännchen begraben sein sollen."
"Gibt es darüber auch eine Geschichte?"
"Na klar."
"Die möchte ich auch hören."
"Diese Geschichte sollte aber besser der Herr Hoffmann erzählen; ich weiß nämlich nicht, ob das noch alles zusammenkriege."
"Der Höhenrücken zwischen Bernardshammer und Derichsberg" fuhr Hoffmann bereitwillig fort, "zeigt viele Spalten, die 'so genannten Quärrisläucher', die von dem Volke, besonders zur Abendzeit, gern gemieden wurden. Da hausten früher die 'Quärrismännchen', seltsame, kleine, langbärtige Kerlchen. Sie schadeten direkt den Leuten nicht, halfen ihnen aber auch nicht. Sie zeigten sich nur, wenn sie die 'Oberirdischen' nötig hatten, und dann galt ihnen als Regel: Wie du mir, so ich dir. Hielten sie in der Erde ihre Festlichkeiten, dann gebrach es ihnen manchmal an Geschirr. Dann kamen sie zu den Anwohnern und borgten, was ihnen fehlte. Stellte man ihnen das Gewünschte gutwillig zur Nacht hin, so hatte man es am folgenden Morgen zurück, und zwar so schön gescheuert, wie es kein Mensch vermochte. Anders, wenn man es ihnen verweigerte. Sie holten es einfach in der Nacht, und sie brachten es zurück, über und über mit Ruß bedeckt.
Der 'Hetzberg', an einer mit düsterem Gestrüpp bewachsenen Talsenkung zwischen Gressenich und der Grube Diepenlinchen, ist sehr verrufen. Dort sieht man an einer Stelle im Abhange mehrere schwere Kalksteinblöcke aufeinandergetürmt. Erfahrene Bergleute halten die Blöcke für eine natürliche Lagerung des Felsgebildes. Das Volk urteilt darüber anders, indem es sagt, daß die Blöcke von Menschenhand übereinandergeschichtet worden seien. Noch bis heute ist der 'Hetzberg' ein gefürchteter Ort, und selbst am Tage soll es da nicht taugen. Man weiß zwar nicht genau warum, nur heißt es: 'Do ligge de Quärrismänncher begrave', und die Steine sollen ihre Grabstätte anzeigen. Kinder, die dort das Vieh hüten wollen, warnte man früher mit den Worten: Do moß de net john, do ligge de Quärrismännche begrave."
 |
Kalksteinformation am
Hetzberg um 1920-30, Privatarchiv W. Hamacher. |
"Anscheinend" erwiderte Josef "waren die Stolberger Zwerge aber nicht so fleißig im Haushalt wie unsere Heinzelmännchen."
Hier aber musste Hubert widersprechen: "Dann sollten Sie aber die Geschichte von den Killewittchen mal hören."
"Waren das etwa auch Zwerge?"
"Sicher doch. Es ist ja bei uns nicht so wie in Köln, wo es nur eine einzige Art von Zwergen gibt."
"Sie machen mich richtig neugierig. Erzählen Sie doch mal."
Hier griff Heinrich Hoffmann wieder in die Unterhaltung ein und schilderte die uralte Geschichte mit folgenden Worten:
"Unfern des Dorfes Hastenrath ist eine Stelle, wo es noch heute im Killewittchen heißt. Dort sah man vor 50 Jahren einen großen Felsen aus Kalkstein, der jetzt vom Bergwerksverein beseitigt ist. In dem Felsen war eine große Höhle, in der kleine Steinbänke standen. Dort haben vor Zeiten die Killewittchen gewohnt. Das waren kleine Zwerge, die sich am Tage nie sehen ließen. In der Nacht verrichteten sie ihre Arbeit. Dabei wollten sie nicht gesehen sein. Die Hastenrather wussten das und ließen sie in Ruhe; denn die Leute standen gut dabei. Zur Zeit der Ernte geschah es oft, dass die reife Frucht, die am Abend noch auf den Halmen gestanden hatte, abgeschnitten war und auf Haufen stand. Die Leute wussten gleich, wer das getan hatte. Wer seinen Pflug im Felde stehen ließ, fand des Morgens seinen Acker frisch gepflügt. Die Killewittchen unterstützten bei ihrer Arbeit besonders die Bauern, die ihre Felder in der Nähe ihrer unterirdischen Wohnungen hatten. Eines Tages waren die Killewittchen fort; wohin sie sich gewandt, und warum sie fortgezogen sind, weiß man nicht. Es wird nur erzählt, vor ihrem Wegzuge hätten sie lange Zeit in der Erde gewühlt, ihre reichen Schätze in Säcke verpackt und mit auf die Reise genommen."
"Das erinnert mich in der Tat an unsere Heinzelmännchen," entgegnete Josef. "Nur die Sache mit den reichen Schätzen hat mit den Kölner Heinzelmännchen wenig zu tun."
"Na siehste," reagierte Hubert, "unsere Zwerge haben eben viel mehr zu bieten als Eure Kölsche Winzlingsgesellschaft."
Und nach einigem Zögern meinte Josef weiter: "Oft schon habe ich darüber nachgedacht, dass in unseren Steinbrüchen häufig schneeweiße Krusten, Tropfsteine und sogar funkelnde Kristalle vorkommen. Kalkspat, so habe ich gehört, wird dieses Zeug genannt und vielleicht waren das ja die Zwergenschätze, die von den Killewittchen - so wie die Leute erzählen - bei ihrem Weggehen eingepackt und mitgenommen worden sind."
 |
So
hat man sich vielleicht das Einpacken der Zwergenschätze
vorzustellen. Bersch, W. 1898: Mit Schlägel und Eisen. |
"Natürlich", entgegnete Josef, "Kalkspat ist zwar ein Allerweltsmineral, aber eben dieser Kalkspat kann manchmal wunderschöne Kristalle bilden, die in der Tat an Edelsteine und durchaus auch an Zwergenschätze erinnern können."
"Dann aber haben die Zwerge längst nicht alles mitgenommen, sondern noch eine ganze Menge hier liegen lassen."
 |
Kalkspat-Kristalle
aus dem „Killewittchen-Steinbruch“, Sammlung und Foto: F. Holtz, H. Wotruba. |
"Kann man mal sehen, wie reich die Zwerge gewesen sein müssen, wenn sie mit ihren Schätzen so sorglos umgegangen sind. Eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, diese Verbindung zwischen Kalkspat und Zwergen. So etwas habe ich von den Kölner Wichteln noch nie gehört, aber dafür haben wir ein wunderschönes Heinzelmännchengedicht, welches ein gewisser August Kopisch geschrieben hat."
"Habe ich auch schon von gehört, können Sie nicht mal eine Strophe aufsagen?"
"Aber sicher, dieses Gedicht kennt bei uns jedes Kind." Und in der Tat, Josef begann, aus dem Stegreif einige Strophen des berühmten Gedichtes aufzusagen, welches ihn von Kindesbeinen an begleitet hatte.
Wie war zu Cöln es
doch vordem
Mit Heinzelmännchen so bequem!
Denn, war man faul, man legte sich
Hin auf die Bank und pflegte sich.
Da kamen bei Nacht,
Eh' man's gedacht,
Die Männlein und schwärmten
Und klappten und lärmten
Und rupften
Und zupften
Und hüpften und trabten
Und putzten und schabten.
Und eh' ein Faulpelz noch erwacht,
War all sein Tagewerk bereits gemacht.
Die Zimmerleute streckten
sich
Hin auf die Spän und reckten sich.
Indessen kam die Geisterschar
Und sah was dort zu zimmern war.
Nahm Meißel und Beil
Und die Säg' in Eil';
Und sägten und stachen
Und hieben und Brachen,
Berappten
Und klappten,
Visierten wie Falken
Und setzten die Balken.
Eh' sich's der Zimmermann versah,
Klapp! stand das ganze Haus schon fertig da.
"Sehr schön," meinte Hubert begeistert, "mit sowas können wir leider nicht dienen."
Nur wenige Jahre später, aber das konnten Hubert und Hoffmann noch nicht wissen, gab es auch ein Gedicht über die Killewittchen. Es wurde von Peter Bündgens verfasst und erschien um 1920 in der Geschichte von Hastenrath. Hier hieß es unter anderem:
Der eine melkt geschickt
die Küh',
Der andere streut das Futter,
Ein dritter dreht mit großer Müh'
Die Milch im Faß zu Butter.
Gestriegelt steht das
Ackerpferd,
Gereinigt sind die Ställe,
Und blank geputzt ist schon der Herd
Und sauber Tür und Schwelle.
Im Gärraum geht es
lustig her,
Da keltern sie die Weine,
Die Weizengarben liegen leer
Gedroschen in der Scheune.
Und sehr viel später, nämlich 1983, erschien ein weiteres Gedicht über die Killewittchen. Der Verfasser war Dr. J. Eschbach.
Dort, wo ein
Höhenrücken die Städte trennt,
die man Eschweiler und Stolberg nennt,
liegt die Landschaft noch heute zerwühlt,
so daß man das Wirken der Zwerge fühlt.
Hier hausten sie
fröhlich in Höhlen und Schächten
man hörte ihr Trappeln in sternklaren Nächten;
tagsüber wurde, geschürzt und bezopft,
unermüdlich nach Kalkstein und Erzen geklopft.
Vollständige Texte der Gedichte
"Was mir bei diesen Killewittchen seltsam vorkommt," überlegte Josef, "ist der Name. Dieser Ausdruck sagt mir überhaupt nichts."
"Dazu kann ich etwas sagen," schaltete sich Hoffmann ein, "zumindest was die Vorsilbe angeht. Diese Vorsilbe Kille hat einen keltischen Wortstamm, ähnlich wie die Begriffe Kuhle, Kaule oder Kull. Gemeint ist hiermit Grube; Grube im Sinne von Bodenvertiefung oder als Bezeichnung für Schürfstellen, aus denen irgendwelche Bodenschätze herausgeholt werden. Diese Vorsilbe deutet also, wenn man so will, auf zweierlei hin. Erstens nämlich müssen die Killewittchen uralt sein, wie der keltische, also vor-römische Wortstamm verrät. Und zweitens scheinen sie, ähnlich wie die Quärrismännchen, etwas mit Bergbau zu tun gehabt haben. Nicht nur die Bedeutung der Vorsilbe "Kille" deutet darauf hin, sondern auch die reichen Schätze, die sie vor ihrem Verschwinden eingepackt haben sollen."
"Das klingt einleuchtend,“meinte Josef,“ außerdem werden Bergbau und Zwerge schließlich fast überall in Beziehung zueinander gebracht."
"Da sprechen Sie jetzt aber einen höchst interessanten Punkt der Stolberger Zwerge an."
"Wieso, das müssen Sie mir erklären."
"Gehen wir noch einmal zurück zu den hilfsbereiten Geistern, zu den Penaten. Nach dem Abzug der Römer müssen diese Geschichten einfach weitergegeben worden sein. Und irgendwann wurde erzählt, die Penaten hätten sich nicht nur im Haushalt, sondern auch im Handwerk und im Bergbau nützlich gemacht. Im Mittelalter jedenfalls tauchen die Penaten in praktisch allen Bergbaugebieten auf; auch dort, wo die Römer nie gewesen sind. Auch hier waren sie hilfsbereite, freundliche Zwerge, die den Bergmann beschützten und ihn bei drohender Gefahr warnten.
Später hat man den Zwergen dann ganz allgemein die Arbeitskleidung der mittelalterlichen Bergleute verpasst, die sogenannte Kapuzentracht. Die Zipfelmützen der Kölner Heinzelmännchen sind also nichts anderes als Kapuzen, wie sie bei den mittelalterlichen Bergleuten üblich waren. In den meisten Montanregionen wurden die Penaten also erst im Mittelalter zu Bergbauzwergen. In Stolberg hingegen scheinen die beiden typischen Merkmale der Zwerge, hilfsbereite Geister nämlich und bergbautreibende Wesen, schon sehr viel früher entstanden zu sein."
"Wer hätte das gedacht, dann habt Ihr ja hier ganz besondere Zwerge, Zwergenunikate sozusagen."
Hier meldete sich Hubert noch einmal zu Wort: "Kannste mal sehen, und uns dann einen vom Meer erzählen wollen."
"Das scheint Sie ja tief getroffen zu haben. Tut mir aufrichtig leid; und dabei haben Sie mir so viel Neues erzählt, habe ich so viel gelernt heute Abend. Darf ich Sie beide vielleicht zu einem Bier einladen."
Für Hubert gehörte nach der harten Steinbrucharbeit der abendliche Gasthausbesuch zum festen Lebensrhythmus. Hier trank er dann ein Glas, und nach besonders heißen Tagen manchmal auch zwei Gläser von dem erfrischenden Bier, was er von seinem Lohn auch leicht bezahlen konnte. Insofern musste er über das Angebot des Fremden also nicht übermäßig erfreut sein, aber die Offerte signalisierte ein Friedensangebot, und eigentlich war ihm der fremde junge Mann ja auch sympathisch, der sich für seine Muschel, für seinen Steinbruch und für seinen Heimatort überhaupt interessierte.
Daher meinte Hubert bereitwillig: "Das ist eine gute Idee. Damit soll der Streit dann auch vergessen sein. Und ich bin der Hubert, wenn Sie möchten."
"Ja gerne, und ich bin der Josef. Zum Wohlsein, auf die Zwergenschar!"
"Sehr zum Wohle," stimmten Hubert und Hoffmann ein "auf die Heinzelmännchen, Killewittchen und Quärrismännchen."
Zu Josef gewandt meinte Hubert: "Ich habe gehört, Du willst morgen zur Grube Diepenlinchen."
 |
Erzgrube
Diepenlinchen, Ölgemälde von Franz Hüllenkremer. |
"Ja, bin ich auch schon sehr gespannt drauf."
"Die Landstraße nach Mausbach macht am Friedhof einen scharfen Knick nach links. Dort kannst Du den Feldweg geradeaus gehen. Unten im Tal hältst Du Dich links und nach gut einem Kilometer kannst Du die Betriebsgebäude schon sehen. Unterwegs siehst Du rechter Hand dann auch die Zwergensteine, wo die Quärrismännchen begraben sind. Pass aber auf, es soll nicht ganz geheuer dort sein."
Hier schaltete sich Heinrich Hoffmann noch einmal ein: "Lassen Sie sich bloß nicht verrückt machen, die Stolberger Zwerge sind alle ganz freundliche, sympathische, liebenswerte Kerlchen. Und für Ihre Grubenfahrt morgen, ein herzliches Glückauf!" Mit diesen und anderen guten Wünschen ging die kleine Gesellschaft auseinander.
Heinrich Hoffmann setzte sein Vorhaben in die Tat um und veröffentlichte Jahre später seine Sagensammlung. Es wurde ein zweibändiges Werk, dem er den Titel "Zur Volkskunde des Jülicher Landes" gab. Im zweiten Band mit dem Untertitel "Sagen des Indegebietes" finden sich auch die Geschichten um die Stolberger Zwerge und um die Sagenstadt Gression wieder. Somit blieben die Erzählungen um unsere Zwerge, Römermännchen sowie Klllewittchen, um Gression und sein unterirdisches Glockengeläut erhalten, auch wenn diese uralten Erzählgebilde heute kaum noch im allgemeinen Bewusstsein präsent sind.
Die Felsformation der von Hubert erwähnten Zwergensteine ist heute stark von Gestrüpp überwuchert und befindet sich schon fast im Betriebsgeländer des ortsansässigen Steinbruchunternehmens. Wenn man die markant ausgebildeten Felsen im Gelände aufgefunden hat, was gar nicht so einfach ist, kann man sich der Aura dieser "sagenumwobenen" Stelle auch heute noch kaum entziehen.
Während seiner Tätigkeit im Steinbruch fand Hubert noch häufig Muscheln, die der Kölner Geologe Brachiopoden genannt hatte und die - streng genommen - auch nicht zu den Muscheln gehörten. Oft musste er noch darüber nachdenken, dass Josef der Meinung gewesen war, sein Steinbruch sei einmal Meer gewesen. Das aber konnte er sich nicht vorstellen. Dann glaubte er schon lieber an eine Flutwelle, welche die Sagenstadt Gression vor langer Zeit hinweggeschwemmt haben soll.
Und nachdem Josef sein Besichtigungsprogramm absolviert hatte, war er wieder nach Köln gefahren. Und immer, wenn er von den Heinzelmännchen hörte - was in Köln natürlich sehr oft geschah - musste er auch an die Stolberger Zwerge denken und an seine erste, größere Exkursion, wo er so viel erlebt und so viel Neues gesehen und gehört hatte.
Von der einst bedeutenden Erzgrube Diepenlinchen, die Josef auf seiner Exkursionstour besucht hatte, steht heute nur noch der kaminartige, schon etwas verfallene Aufbau des Froschschachtes im Industriegebiet Mausbach. Dem Vernehmen nach soll er sogar unter Denkmalschutz gestellt worden sein, und eingezäunt hat man ihn mittlerweile auch. Wind und Wetter jedoch zeigen sich wenig beeindruckt von beiden Maßnahmen und nagen unbeirrt weiter an diesem Zeitzeugen der Frühindustrialisierung, dem letzten Relikt der bekanntesten und größten Erzgrube unseres Raumes.
 |
Der
Froschschacht, Wetterschacht der Erzgrube Diepenlinchen, Foto: F. Holtz. |
| Startseite | Graphiken | Kaleidoskop | Touristisches |
Prolog:
Die Personen in dieser Geschichte und ihre Handlungen sind frei erfunden. Lediglich der Geschichten- und Sagensammler Heinrich Hoffmann hat einen realen historischen Hintergrund. Ob dieser jedoch jemals Gast im Gressenicher "Pannes" gewesen ist und hier sogar bestens bekannt war, muss mit Fug und Recht bezweifelt werden. Man darf allerdings vermuten, dass Hoffman bei entsprechenden Gelegenheiten ganz ähnlich, nämlich so freundlich und interessiert reagiert hätte, wie in dieser Geschichte unterstellt wird.