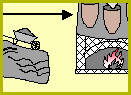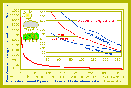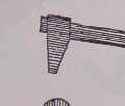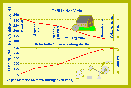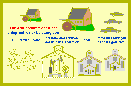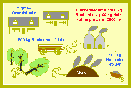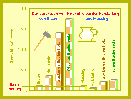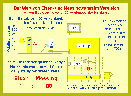Die Zeit der
Kupfermeister
Wie bei der Betrachtung der Energiebedürfnisse schon
angedeutet,
wurden die hiesigen Galmeivorkommen
in nach-römischer Zeit zuerst wieder von den Kupfermeistern
genutzt, allerdings erst nach einer langen, langen Pause. Mit
dem Eindringen der Franken nämlich kamen Erzabbau und -
verarbeitung
zunächst völlig zum Erliegen, da sich nunmehr eine
vorwiegend
auf Agrarertrag ausgerichtete Wirtschaftsstruktur entwickelte.
Erst im 10. Jahrhundert scheint das Messinggewerbe im Bereich
unserer Erzgangzüge
erneut eine nennenswerte Bedeutung erlangt zu haben. Allerdings
hat diese nach-römische Epoche nicht in Stolberg begonnen,
sondern im Maastal, vornehmlich in den Städten Dinant
und Huy. Ganz ähnlich wie hier bei uns gab es im Maastal
auch Galmeivorkommen, und die
Lagerstättenverhältnisse
waren mit denen von Stolberg fast identisch, ganz einfach schon
deshalb, weil sie der gleichen Paragenese
zuzurechnen sind.
Der bereits erwähnte Wechsel von gegossenen zu
ausgehämmerten,
getriebenen Messingwaren war in Dinant und Huy schon ganz zu Anfang
eingetreten, und eben diese getriebenen Messingprodukte sollten
über Jahrhunderte kennzeichnend bleiben für die
Messingverarbeitung
in unserem Raum. In Anlehnung an den Herkunftsort Dinant stand
und steht der Begriff 'Dinanderien' auch heute noch als Synonym
für kunstvoll getriebenes Messinggerät.

|

|
Kerzenleuchter aus getriebenem Messingblech
(Dinanderien) in der alten Abteikirche Kornelimünster.
Fotos: F. Holtz
|
Kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Herzog von Burgund
und seinem Sohn (später Karl der Kühne genannt)
führten
1466 zur Zerstörung der Messingstädte an der Maas.
Die
(Kupfer-) bzw. Messing-Schläger, die so genannten Batteurs,
siedelten sich unter anderem in der Freien und Reichsstadt Aachen
an und leiteten somit, zunächst nur für Aachen, die
Epoche der Kupfermeister ein.
Mit dem kurz vor den Toren Aachens gelegenen Altenberg
stand eine außergewöhnlich ergiebige
Galmeilagerstätte
zur Verfügung, die zudem auch qualitativ hochwertigen Galmei
lieferte. Möglicherweise sogar haben Ergiebigkeit und
Reichhaltigkeit
der Erzmittel vom Altenberg auch einen Wandel bezüglich der
Einstellung und Wertvorstellung zu dem Werkstoff Messing bewirkt,
der zunehmend als Gebrauchsmetall und nicht mehr so sehr als Ziermetall
angesehen wurde. In der Tat lässt sich sagen, dass in Aachen,
sowie auch später in Stolberg, überwiegend
Gerätschaften
des täglichen Gebrauches produziert und in sehr viel
geringerem
Maße Kunstgegenstände gefertigt wurden, als dies
vorher
in Dinant der Fall gewesen war. Für die Gilde der
Töpfer
in Raeren, Langerwehe und Frechen allerdings hatte genau dieser
Wandel fatale Konsequenzen. Das in großen
Stückzahlen
hergestellte Messinggerät war deutlich leichter, sehr viel
handlicher und vor allen Dingen weniger zerbrechlich als
Töpferwaren,
die zunehmend vom Markt verdrängt wurden.
Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wanderten
die
fast ausschließlich protestantischen Aachener Kupfermeister
nach Stolberg aus, weil sie sich mit der einsetzenden Gegenreformation
zunehmend Repressalien ausgesetzt sahen. Und dieser Kausalsatz,
genau diese Begründung nämlich, könnte den
Eindruck
entstehen lassen, dass der Messingstandort Stolberg eigentlich
nur zweite Wahl gewesen sei, da die aus Aachen vertriebenen
Kupfermeister
sich ja zwangsläufigerweise irgendwo - warum also nicht auch
in Stolberg - ansiedeln mussten.
Religion und Standortfaktoren
Der Eindruck, Stolberg könne für die Kupfermeister
eine
Verlegenheitslösung gewesen sein, dieser durchaus
mögliche
Eindruck wäre nun aber völlig falsch. Diese
Auffassung
ist einerseits gänzlich unstrittig, deutet andererseits aber
auch auf eine gewisse Unstimmigkeit in der Argumentation hin,
wenn man als einzige Begründung angibt, die Kupfermeister
hätten Aachen aus religiösen Gründen
verlassen.
In der Tat waren die Standortvorteile in Stolberg so evident,
dass man sich manchmal in der Literatur schwer damit getan hat,
die religiösen Motive der Kupfermeister bei der Umsiedlung
nach Stolberg glaubwürdig darzustellen.
Eines aber ist ganz klar, die Kupfermeister befanden sich in
Aachen zeitweise in einer sehr schwierigen, bedrohlichen Situation.
Man denke nur an den Erlass des 'Eselsbegräbnisses', wonach
die Protestanten nicht ordentlich begraben, sondern wie ein
Stück
Vieh verscharrt werden sollten.
Aber was denn eigentlich ließ die protestantischen
Kupfermeister
hoffen, in Stolberg ihre Religion ungestört ausüben
zu können, in einem Gebiet, dessen Landesherren der Abt von
Kornelimünster, der Herzog von Jülich und zu einem
kleineren
Teil die Stolberger Lehensherren eben jener Jülicher
Herzöge
waren, die aus antiprotestantischer Gesinnung die Kupfertransporte
nach Aachen widerrechtlich sperrten. Auch dem Abt von
Kornelimünster
konnte sicherlich nicht ohne weiteres unterstellt werden, mit
den Protestanten zu sympathisieren.
Trotz dieser Unstimmigkeiten haben wir eine Tatsache
hinzunehmen,
den Fakt nämlich, dass die protestantischen Kupfermeister
in Stolberg offenbar willkommen waren und dort in Frieden ihrem
Gewerbe sowie ihrer Religion nachgehen konnten, alles Dinge also,
die in Aachen auf Dauer jedenfalls nicht möglich gewesen
waren. Man wird nun sicher einwenden können, dass die
Landesherren
durch die (damals wie heute) üblichen Abgaben ganz
beträchtliche
wirtschaftliche Vorteile gehabt haben, aber das hätte
eigentlich
gleichermaßen auch für Aachen gelten müssen.
Diese nicht ganz von der Hand zu weisenden Unstimmigkeiten
scheinen durchaus auflösbar, wenn man die Standortfaktoren,
und hiervon insbesondere die Wasserkraft, etwas näher und
detaillierter betrachtet. Auflösbar scheinen die
erwähnten
Unstimmigkeiten übrigens sogar in einem Sinn, der
Standortfaktoren
zwar mit ins Kalkül einbezieht, den Kupfermeistern jedoch
religiöse Motive bei der Übersiedelung
überhaupt
nicht abspricht.
Wie bereits erwähnt, wurden in Aachen erstens fast
ausschließlich
getriebene Messingwaren und diese wiederum zweitens als
Gebrauchsgegenstände
des täglichen Bedarfs in zunehmend großen
Stückzahlen
hergestellt. Wenn man nun bedenkt, dass nach dem Brennen des Messings
zunächst relativ dicke Platten gegossen wurden, die bei der
Herstellung von Fertigprodukten auf Blechstärke
ausgehämmert
werden mussten, so ist sofort einsichtig, dass eine Mechanisierung
dieses Aushämmerns sicherlich sehr vorteilhaft gewesen
wäre.
Hierzu hätte es allerdings mechanischer Antriebskraft
bedurft, die sich in ausreichender Menge eigentlich nur aus der
Wasserkraft der Bachläufe gewinnen ließ. Nun wurde
dieses Wasser jedoch bereits völlig von anderen Gewerbezweigen
(von den Tuchmachern beispielsweise) genutzt. Es bestand sogar
ein Verbot, wassergetriebene Hammerwerke zum Austreiben des Messings
zu errichten bzw. zu betreiben.

Skizze: F. Holtz
Mit diesem Verbot, so sollte man meinen, hätten die
Aachener
Unternehmer, welche die Wassergerechtsame innehatten, eigentlich
zufrieden und vollkommen beruhigt sein können. Es
wäre
allerdings durchaus ebenso vorstellbar und auch recht naheliegend,
dass diese Unternehmer um ihr Privileg fürchteten. Diese
Furcht wäre sogar sehr verständlich, denn die
Kupfermeister
waren wirtschaftlich sehr gut gestellt, nicht ohne politischen
Einfluss und auch im Stadtrat - zeitweise sogar stark
überproportional
- vertreten. Die Gilde der Kupfermeister war also ein wirtschaftlicher
und politischer Faktor, mit dem man rechnen musste und der im
Falle eines Interessenkonfliktes sehr wohl auch Anlass zu
Befürchtungen
geben konnte.
Ein Interessenkonflikt lag aber zweifelsohne vor, ein
Interessenkonflikt,
der durch die Strömungen der Gegenreformation offensichtlich
eine ganz andere, nämlich eine politische und
religiöse
Dimension erhielt. Es ist durchaus fraglich, ob die Gegenreformation
für die Kupfermeister in Aachen ähnlich ernste
Konsequenzen
gehabt hätte, wenn dieser Konflikt um Einfluss, Macht und
Wasserkraft nicht bestanden hätte. Man erkennt das auch daran,
dass ganz kurz bei Aachen, im oberen Vichttal nämlich, die
teilweise ebenfalls protestantischen Eisenhüttenleute, die
so genannten Reitmeister
auch während der Gegenreformation nahezu unbehelligt blieben,
obschon sie sich im Gebiet der Jülicher bzw.
Kornelimünsterischer
Herrschaft befanden.
Die Querelen und Auseinandersetzungen um Einfluss, Macht und
Ressourcen scheinen selbst in Aachen von beiden Seiten nicht mit
letzter Konsequenz ausgetragen worden zu sein, wie das eigentlich
für einen Konflikt mit radikal-religiösem Hintergrund
typisch wäre. Während sich auch in der Reichsstadt
Tendenzen
einstellten, die abwandernden Kupfermeister und ihre Wirtschaftskraft
an Aachen zu binden, behielten die 'vertriebenen', nunmehr in
Stolberg ansässigen Kupfermeister teilweise sogar
Niederlassungen
in Aachen, was ihnen die Möglichkeit gab, die Handelsvorteile
der freien Reichsstadt zu nutzen, wobei diese Niederlassungen
im protestanten-feindlichen Aachen durchaus geduldet wurden. Geduldet
wahrscheinlich deshalb, weil sich mit der Auswanderung der
Kupfermeister
der bestehende Interessenkonflikt aufzulösen begann; ein
Konflikt, der einerseits offensichtlich bestimmt war durch
Wirtschaftsinteressen,
der sich andererseits jedoch in seinen Auswirkungen für die
Kupfermeister als Unterdrückung darstellen musste. Einen
ähnlichen Konflikt, wenn auch ohne den ideologisch
eingefärbten
Aspekt unterschiedlicher Religionsgemeinschaften, hat es sehr
viel später auch in Stolberg gegeben. Diesmal allerdings
ging es um den Zugriff auf die knapper werdende Holzkohle,
die sowohl von den Kupfermeistern als auch von den Reitmeistern
gleichermaßen dringend benötigt wurde. Aus rein
betriebswirtschaftlichen
Gründen, worauf später noch näher einzugehen
sein
wird, saßen jetzt aber die Kupfermeister am längeren
Hebel, und diese scheuten sich überhaupt nicht, ihre
protestantischen,
eisenschaffenden Glaubensbrüder aus dem Vichttal zu
verdrängen,
indem sie die knapper werdende Holzkohle zunehmend für ihr
Messinggewerbe vereinnahmten.
Die Standortvorteile
Verbleiben wir aber zunächst noch bei der Auswanderung der
Kupfermeister von Aachen nach Stolberg. Im neuen Siedlungsgebiet,
im Stolberger Tal also, stellte sich die Situation gänzlich
anders dar als in Aachen. Die Wasserkraft des Vichtbaches
wurde
nur im Obertal von den Eisenhüttenleuten genutzt und stand
im mittleren bzw. unteren Talabschnitt noch weitgehend zur freien
Verfügung. Bei dieser Konstellation konnte den jeweiligen
Landesherren aus wirtschaftlichen Gründen eine Ansiedlung
nur recht sein.

|
Vichtbach, Detail aus dem
Vichttalplan von E. Walschaple. |
Neben der Wasserkraft gab es auch die bereits
erwähnte
Holzkohle, die sich aus den anfangs reichlich, später jedoch
nur noch spärlich vorhandenen Buchenwaldbeständen der
nördlichen Eifel gewinnen ließ.
Der Bedarf an Heizmaterial (Klafterholz und später
fast
nur noch Steinkohle) zum Beheizen der Schmelzöfen wurde durch
die waldreiche Umgebung bzw. durch die Steinkohlevorkommen im
Norden Stolbergs abgedeckt.
Es gab nun aber, wie sich nach der Beschreibung der
Erzlagerstätten
denken lässt, noch einen weiteren, eigentlich sogar 'den'
entscheidenden Standortfaktor überhaupt. Und dieser bei weitem
wichtigste und entscheidende Standortvorteil war gekennzeichnet
durch kurze und günstige Transportwege zu dem unentbehrlichen
Betriebsstoff Galmei,
der erstens den mengenmäßig weitaus dominanten
Bedarfsanteil
abdeckte, der zweitens in und um Stolberg in den
Kalksteinzügen
zu finden war, und der sich zudem drittens auf Grund der
Lagerstättenverhältnisse
relativ leicht und problemlos abbauen ließ.
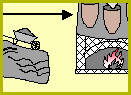
Skizze: F. Holtz
Es war also, lässt sich zusammenfassend sagen, im
Stolberger
Tal alles Notwendige vorhanden; alles, außer Kupfer,
welches hauptsächlich aus den Lagerstättengebieten
des
Mansfelder Kupferschiefers herangeschafft werden musste.
Aber dieser Kupfertransport war das kleinere Übel,
weil
man zur Messingherstellung, bezogen auf das eingesetzte Kupfergewicht,
doppelt so viel Galmei benötigte. Und hauptsächlich
diese Gewichtsmengenverhältnisse, zusammen natürlich
mit den anderen Standortgegebenheiten, waren verantwortlich
für
den Erfolg des Messinggewerbes. Die Entwicklung verlief,
gestützt
durch eben diese Standortvorteile, in unserer Region so
günstig,
dass man bald schon alle damals bekannten Absatzmärkte
beherrschte
und im 18. Jahrhundert eine monopolartige Stellung innehatte.
Dieser Erfolg und die dahinterstehenden
Produktionsaktivitäten
nahmen natürlich auch Ressourcen in Anspruch; Ressourcen,
die eigentlich nie und nirgendwo in unbegrenztem Umfang zur
Verfügung
stehen. Und so musste sich auch im Stolberger Tal die vorgegebene
Limitierung der natürlichen Ressourcen irgendwann bemerkbar
machen. Es wurde ganz einfach zu eng am Vichtbach weil die
verfügbare
Wasserkraft auch hier nicht mehr ausreichte. Man musste also ausweichen
und den Münsterbach (gemeint ist hiermit, entsprechend der
früher üblichen Terminologie, der Oberlauf der Inde),
den Unterlauf der Inde und auch die Antriebskraft der Wehe mit
in die Nutzung einbeziehen. Hierzu mussten natürlich
Kupferhöfe
und Hammermühlen entlang dieser Bachläufe errichtet
werden.
Wenn wir also rückblickend die ganze
Weitläufigkeit
des Siedlungsgebietes der Kupfermeister betrachten, die geographische
Ausdehnung der Messingregion sozusagen, und dabei
berücksichtigen,
dass zur Abdeckung der erforderlichen Antriebskraft genau diese
Weitläufigkeit zwingend erforderlich war, können die
Streitigkeiten im engen Aachen sowie deren Verlauf und Ausgang
kaum noch als relevant für die weitere Entwicklung angesehen
werden. Gleichgültig ob diese Streitigkeiten vorwiegend oder
nur vordergründig religiösen Hintergrund hatten, die
Entwicklung und Zukunft der Messingfabrikation und somit der
Kupfermeisterfamilien
selbst konnten innerhalb der Stadt Aachen nicht abgesichert werden.
Ob mit oder ohne Interessenkonflikt und unabhängig davon,
welcher Art dieser Konflikt auch gewesen sein mag, die Kupfermeister
hätten Aachen im Laufe der Entwicklung ohnehin verlassen
müssen, um ihren Hunger nach mechanischer Antriebsenergie
dort zu stillen, wo dies mit den damals zu Gebote stehenden Methoden
möglich war: an den Bachläufen unserer Region.

|
Die Jan Ravens Mühle
um 1544
Aquarell nach Walschaple
von G. Dodt |
Berücksichtigt man nun noch die geographische
Verteilung
der Galmeilagerstätten, so ist der Standort Stolberg eben
nicht zweite Wahl (nach und gemessen an Aachen) gewesen, sondern
war im Gegenteil ganz hervorragend geeignet, wie ja auch die weitere
Entwicklung gezeigt hat. Wenn nun aber neben und nach dem Vorhandensein
des Galmeis die Wasserkraft von so entscheidender Bedeutung gewesen
ist, dürfte es sicherlich von Interesse sein, die Wasserkraft
am Beispiel des Vichtbaches einmal quantitativ abzuschätzen,
um zumindest einmal eine grobe Vorstellung von der
Grössenordnung
zu erhalten. Im Folgenden soll daher versucht werden, den
Energiebeitrag
überschläglich zu bestimmen, den der Vichtbach
geliefert
hat und von dem einerseits sowohl die Kupfermeister als auch die
Reitmeister profitierten, den sie sich andererseits jedoch auch
teilen mussten.
Die Wasserkraft der Vicht
Zunächst einmal ist völlig klar, dass der Vichtbach
gespeist wird aus einem Gebiet, das nahezu vollständig der
niederschlagreichen Vennfußfläche zuzurechnen ist.
Obschon uns diese Tatsache auf Grund der Erfahrung manch
trüber
Tage sicherlich bewusst ist, machen wir uns normalerweise wenig
Gedanken darüber, dass genau diese Tatsache auch Teil eines
komplexen Geflechtes ist, das wir in seiner Gesamtheit eben
'Standortbedingungen'
nennen.
Aus lauter Freude an der Wasserkraft und an den hier
beginnenden
Eifelbergen, welche erstens die von See kommenden Wolken emportreiben
sowie zum Abregnen veranlassen, und welche zweitens für ein
leistungsbringendes Gefälle der Bachläufe sorgen,
sollten
wir einen ebenfalls wichtigen Aspekt auch nicht vergessen: Die
Tatsache nämlich, dass sich das Stolberger Tal gegen Norden
hin zur Rheinischen Tiefebene öffnet. Die Bäche
fließen
hier erheblich ruhiger und sind auf Grund des geringeren
Gefälles
als Energieträger sehr viel weniger geeignet. Dafür
aber ist das Flachland zum Warentransport natürlich
günstiger
als das recht unzugängliche Bergland der Eifel.
Leistungsbringendes
Gefälle und transportgünstiges Flachland, zwei
Standortfaktoren,
die sich gegenseitig ausschließen, deren Vorteile sich jedoch
beide nutzen lassen, wenn der Standort - wie in Stolberg - auf
der Nahtstelle der beiden Landschaftsformen liegt.
Im Prinzip ist nun eine Abschätzung der
Vichtbachenergie
sehr einfach. Man braucht nämlich nur den
Höhenunterschied
(das Gefälle also) und die Wasserführung
(Wasservolumen
pro Zeiteinheit) zu wissen. Wer aber den Vichtbach kennt,
weiß,
dass er manchmal (nach längeren Regenperioden) zum
reißenden
Strom wird, oft als ruhig dahinplätschernder Bach das Tal
durchzieht oder vorzugsweise im Sommer zum spärlichen Rinnsal
werden kann. Angesichts dieser extrem wechselnden Verhältnisse
ist die Abschätzung einer durchschnittlichen oder einer
für
den Jahresverlauf repräsentativen Wasserführung
natürlich
nicht mehr ganz so einfach. Glücklicherweise hatte das
Staatliche
Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft im Bereich Platenhammer
- Jägersfahrt (zwischen Vicht und Zweifall) einen Messpegel
installiert und stellte die dort während eines Zeitraumes
von über 20 Jahren gesammelten Messwerte freundlicherweise
zur Verfügung. Damit nicht genug, die Ergebnisse waren sogar
so aufbereitet, dass eine auf unsere Fragestellung zugeschnittene
Interpretation möglich wurde.
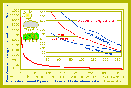
Skizze: F. Holtz
Bei Hochwasserführung erreicht der Vichtbach
Abflussmengen
von weit über 10.000 Litern pro Sekunde (siehe Graphik).
Wer sich dieses Naturschauspiel einmal angesehen hat, wird eigentlich
sofort einsehen, dass diese reißenden, brodelnden
Wassermassen
im Sinne einer technisch beherrschbaren Nutzung nicht zu
bändigen
waren und für die Energiegewinnung kaum in Frage kamen. Selbst
wenn eine technische Nutzung mit Hilfe einer Vielzahl von riesigen
Mühlrädern in Verbindung mit gewaltigen
Arbeitsmaschinen
möglich gewesen wäre, hätten derartig
gigantische
Anlagen wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn gemacht, da
sie nur wenige Tage im Jahr (nämlich bei extremer
Hochwasserführung)
zu betreiben gewesen wären.
Auslegung der Antriebe
Man musste also schon bei der Auslegung der Antriebe und
Arbeitsmaschinen
eine wirtschaftlich vertretbare, vernünftige
Größenordnung
finden, die nicht nur wenige Tage im Jahr nutzbar war, sondern
ein möglichst günstiges
Kosten/Nutzen-Verhältnis
gewährleistete. Die erwähnte Auslegung bezog sich
übrigens
nicht nur auf die Mühlräder selbst, sondern
zwangsläufigerweise
auch auf die Anlage der Wassergräben (Mühlteiche),
auf
die Konstruktion bzw. Anzahl der Arbeitsmaschinen und beeinflusste
somit die Höhe der Erstellungskosten ganz erheblich.
Die maximal nutzbare Leistung und somit auch die
durchschnittliche
Jahresleistung hing also auch entscheidend von der Auslegung der
installierten Wasserkraftanlagen ab. Man konnte nämlich bei
entsprechend großem Wasserangebot die
Mühlräder
nicht beliebig schneller drehen lassen, denn bei einem Hammerwerk
beispielsweise wäre den Hämmern irgendwann nicht mehr
genügend Zeit verblieben, auf den Amboss
zurückzufallen.
Das Erreichen eines derartig unsinnigen Betriebszustandes wäre
vermutlich allerdings ein Glücksfall gewesen, denn lange
vorher schon wären die Antriebswellen oder die Antriebsnocken
oder die Hammerstiele auf Grund der auftretenden
Beschleunigungskräfte
wahrscheinlich zu Bruch gegangen. Es blieb also nichts anderes
übrig, als bei Hochwasser das vorhandene Energiepotential
ungenutzt vorbeirauschen zu lassen.
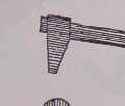
|
Hammerwerk nach
Krünitz |
Jetzt taucht natürlich sofort die Frage auf,
für
welche maximale Wasserführung bzw. Leistung die
Mühlenanlagen
wohl ausgelegt waren. Diese Frage lässt sich heute nur noch
über eine Abschätzung der Wirtschaftlichkeit
beantworten.
Es ist ganz klar, Wassermengen oberhalb von 1000 Litern pro Sekunde
sind für die Energiegewinnung wohl uninteressant gewesen,
da sie nur ungefähr 70 Tage im Jahr verfügbar waren
und fast 10 Monate im Jahr eben nicht erreicht wurden. Würden
damals bereits Talsperren existiert haben, wäre das eine
andere Sache gewesen, da diese auf Grund ihres Speichervolumens
eine gleichmäßigere Abflussmenge über das
ganze
Jahr ermöglicht hätten.
Um die Verteilung der Wasserführung unterhalb von
1000
Litern pro Sekunde etwas genauer betrachten zu können, ist
dieser Bereich im oberen, rechten Teil der Graphik nochmals
vergrößert
dargestellt.
Es kann sich zwar wirklich nur um eine Abschätzung
der
Größenordnung handeln, aber es gibt 3 gute
Gründe
anzunehmen, dass die Anlagen für eine Wassermenge von 400
- 500 Litern pro Sekunde ausgelegt waren. Zwei dieser Gründe
können und sollen sofort angeführt werden,
während
der dritte Grund erst im Laufe unserer weiteren Betrachtungen
einsichtig werden wird.
Der erste Grund ist rein statistischer Natur, aber trotzdem
sicherlich relevant und aussagekräftig. Eine
Wasserführung
von mindestens 450 Litern pro Sekunde wird nämlich an
ungefähr
180 Tagen im Jahr erreicht. Das heißt, genau dieser Wert
wird - betrachtet über ein ganzes Jahr - zur Hälfte
der Zeit überschritten und zur anderen Hälfte der
Zeit
unterschritten. Mit anderen Worten, an jedem beliebigen Tag ist
die Chance, eine höhere Wasserführung als 450 Liter
pro Sekunde vorzufinden genau 50% und die Wahrscheinlichkeit einer
geringeren Wasserführung ebenfalls genau 50%. Man kann also
keinen anderen Einzelwert angeben, der die Wasserführung
eines ganzen Jahres besser repräsentiert.
Der zweite Grund ergibt sich aus der Kurvenform. Bei einem
Wert von 450 Litern pro Sekunde nämlich knickt die Kurve
relativ steil nach oben ab. Die Nutzungsmöglichkeiten der
Gesamtanlagen nahmen somit stark progressiv ab, wenn deren
Kapazität
den Wert von 450 Litern pro Sekunde überschritt.
Nun wird man vielleicht einwenden können, dass
Datenmaterial
ähnlich guter Qualität damals als Planungsunterlage
nicht zur Verfügung stand. Das ist sicher richtig, aber man
sollte schon bedenken, dass die beiden zur Diskussion stehenden
Wirtschaftszweige einige Jahrhunderte Zeit hatten, sich im Vichttal
zu entwickeln und, dass während dieser Zeit
evolutionsähnliche
Mechanismen abliefen, die wirtschaftlich sinnvolle, nahezu optimal
angepasste Gesamtanlagen entstehen bzw. überleben
ließen.
Eine Anlagenauslegung für 450 Liter pro Sekunde
hatten
wir also angenommen, eine Wassermenge, die genau während
der Hälfte eines Jahres (allerdings nicht einer zeitlich
zusammenhängenden Hälfte) zur Verfügung
stand.
Und hier könnte jetzt der nächste Einwand kommen, der
Einwand nämlich, dass hiernach eine volle Maschinenausnutzung
nur während 50% der Zeit möglich war, was
für den
Betreiber natürlich nicht befriedigend gewesen sein konnte.

|
Der Dollartshammer
um 1544
Aquarell nach Walschaple von G. Dodt |
Die damals üblichen Betriebszeiten erstreckten sich
jedoch
üblicherweise auf nur 12 Stunden pro Tag, und - welch ein
Glück - der Vichtbach kannte keine Nachtruhe. Nur die
Schmelzöfen
(und der Vichtbach) liefen nachts weiter, wozu nur wenig Antriebswasser
zum Betrieb der Blasebälge gebraucht wurde. Somit konnte
der Hauptteil des Wassers in Speicherbecken (Mühlteiche,
Weiher) gesammelt werden und stand somit für die
Betriebszeiten
bereit.
Berücksichtigt man nun noch den Sonntag als Ruhezeit,
so kann man annehmen, dass eine Wasserführung von 225 Litern
pro Sekunde (die Hälfte von 450) ausreichte, die Anlagen
12 Stunden an 6 Tagen der Woche voll auszunutzen und während
der Nacht die Blasebälge (und nur diese) zusätzlich
betreiben zu können. Diese Wassermenge von 225 Litern pro
Sekunde stand jedoch an mehr als 300 Tagen im Jahr zur
Verfügung,
und - je nach Länge und Verteilung der Trockenperioden -
konnte ein Teil der restlichen Niedrigwassertage noch durch die
Speicherkapazität der Mühlteiche
überbrückt
werden.
Wassernotstand
Bei unserer angenommenen Auslegungskapazität der Gesamtanlagen
müssten die Kupfer- und Reitmeister also eigentlich aus dem
Schneider gewesen sein. Es ist nun aber überliefert, dass
es gelegentlich zu ernsten, manchmal sogar zu handgreiflichen
Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Kupferhöfen um
Antriebswasser gekommen ist. Wenn unsere bisherigen Annahmen nun
realistisch sind, müssten auch diese Schwierigkeiten an Hand
des vorliegenden Datenbestandes nachvollziehbar sein. Und in der
Tat, wenn wir die untere Grenzkurve betrachten, wird deutlich,
dass es Jahre gegeben haben muss, in welchen eine ausreichende
Wassermenge (225 Liter pro Sekunde) an nur 250 Tagen erreicht
wurde. Das ist gleichbedeutend mit fast 4 Monaten im Jahr, in
welchen weniger Wasser zur Verfügung stand als eigentlich
benötigt wurde. Man kann sich leicht vorstellen, was das
bedeutete.
Es kommt aber noch eine andere Überlegung hinzu.
Während
der verfügbare Beobachtungszeitraum von etwa 20 Jahren zur
Bestimmung einer durchschnittlichen Jahresverteilung der
Wasserführung
vollkommen ausreicht, ist die Situation bei den Grenzkurven
hinsichtlich
ihrer Aussagekraft sehr viel kritischer. Es dürfte sofort
einsichtig sein, dass bei einem erheblich längeren
Beobachtungszeitraum
durchaus Jahre zu erwarten wären, in denen alles noch viel
schlimmer kommt. Oder rückblickend betrachtet, muss es
während
eines langen Erfahrungszeitraumes halt auch Jahre gegeben haben,
in denen alles eben noch viel schlimmer gewesen ist, als von den
eingezeichneten Grenzkurven gezeigt wird.
Im Umkehrschluss heißt das aber eben auch, dass die
aus
der Geschichte anklingenden Schwierigkeiten nicht notwendigerweise
auf unternehmerisch unsinnige Entscheidungen bei der Planung und
Auslegung der Anlage hindeuten, sondern, dass man in Extremjahren
auch bei betriebswirtschaftlich sinnvoll ausgelegten Anlagen Probleme
hatte.

Foto: F. Holtz
Antriebsleistung
Bei der stark schwankenden Wasserführung und der Verteilung
der Betriebszeiten waren die bereits angesprochenen Speicherbecken
einerseits unbedingt erforderlich, hatten andererseits jedoch
eine weitere, diesmal allerdings negative Konsequenz. Da Druckleitungen
zu den Mühlrädern nicht bekannt waren, reduzierte
sich
das nutzbare Bachgefälle (bzw. das am Mühlrad wirksam
werdende Gefälle der Antriebswassergräben) um die
nutzbare
Tiefe der Speicherbecken. Diesen Umstand sollten wir bei der
Abschätzung
des Wirkungsgrades nicht aus den Augen verlieren.
Aber eigentlich wären wir jetzt endlich soweit,
einmal
eine Leistungsangabe machen zu können. Unter den diskutierten
Prämissen bezüglich der Wasserführung, der
Auslegung
der Anlagekapazität und bei dem vorgegebenen Gefälle
zwischen Zweifall und der Mündung in die Inde ergibt sich
für dieses Stück des Vichtbaches eine Gesamtleistung
von 480 PS.
Entsprechend der im Vichttal vorliegenden geographischen
Verteilung
der Messingindustrie und des Eisenhüttengewerbes entfiel
von dieser Gesamtleistung etwa 2/3 auf die Kupfermeister und
ungefähr
1/3 auf die Reitmeister, wenn man annimmt, dass die Grenze zwischen
den beiden Wirtschaftszweigen im Bereich Nachtigällchen -
Bernardshammer gelegen hat. Von der tatsächlichen Aufteilung
des Gefälles her stimmt das zwar nicht ganz, aber da
wäre
auch noch zu berücksichtigen, dass das von den Reitmeistern
angestaute Vorratswasser nach dem Durchlauf durch die
Reitmeistermühlen
den Kupfermeistern wieder als Antriebswasser zur Verfügung
stand, wodurch sich deren Anteil bei Niedrigwasser etwas
erhöhte.
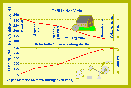
Skizze: F. Holtz
Es ist ja bereits schon angedeutet worden, diese an sich
nutzbare
Energie des Vichtbaches von 480 PS konnte, insbesondere bei dem
damaligen technischen Standard, nicht verlustfrei in mechanische
Antriebsenergie umgewandelt werden. Wenn wir also wissen wollen,
was letztendlich an Antriebsleistung wirklich zur Verfügung
stand, müssen diese Umwandlungsverluste natürlich
noch
abgezogen werden. Man kann davon ausgehen, dass der Wirkungsgrad
derartiger Anlagen bei vielleicht 30 oder 40% gelegen haben wird.
Wem dieser Wert zu gering erscheint, der möge die eigentlichen
Arbeitsmaschinen in die Betrachtung mit einbeziehen, und dann
nämlich wäre ein Gesamtwirkungsgrad in einer
Größenordnung
von 35% schon recht optimistisch.
Rein rechnerisch wären wir somit bei 168 PS nutzbarer
Antriebsleistung. Diesen Wert jedoch können wir so nicht
stehen lassen, eigentlich schon deshalb nicht, weil hierdurch
eine Genauigkeit vorgetäuscht würde, die nun wirklich
überhaupt nicht vorhanden ist. Eingangs wurde ja bereits
gesagt, dass es nur darum gehen kann, die
Größenordnung
abzuschätzen. Und, wie der Name schon sagt, der Vichtbach
soll als Antriebsgröße eingeordnet werden, wozu
Genauigkeit
weniger gefordert ist als vielmehr ein realistischer Richtwert,
und den wiederum sollten wir vielleicht bei runden 200 PS annehmen.
200 PS, eine runde, mehr oder weniger exakte Zahlenangabe,
die ihrerseits natürlich wiederum subjektiv Interpretierbar
ist; interpretiertbar hinsichtlich Bedeutung und Wertigkeit. Und
hierbei kommt es, wie so oft, auch ganz entscheidend auf den eigenen
Standpunkt an. Aus der Sicht der damaligen Zeitepoche sind 200
PS sicherlich sehr viel gewesen, konnte doch ein gesunder Gaul
selbst in seinen besten Jahren eine Dauerleistung von einer
'Pferdestärke'
nicht auf die Beine stellen.
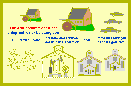
Skizze: F. Holtz
Selbst zur Anfangszeit der Dampfmaschine waren 200 PS noch
eine ganze Menge. Dampfmaschinen von 20 PS waren gewaltige, teure
und haushohe Konstruktionen, wovon man immerhin 10 Stück
gebraucht hätte, um mit der Antriebskraft der Vicht
gleichziehen
zu können.
Aus heutiger Sicht klingen 200 PS als Grundlage zweier
bedeutender
Wirtschaftszweige eher lächerlich. Viele Einzelfamilien
verfügen
heute, rechnet man den Zweit- und Drittwagen mit ein, über
ein Antriebspotential, mit dem sich alle Kupfer-
und Reitmeister
des
Stolberger Tales zusammen und anteilmäßig
begnügen
mussten. So befremdlich es heute auch klingen mag, der Vichtbach
mit seinen 200 PS in Verbindung mit der Wasserkraft von Inde und
später auch Wehe trieb nicht die Maschinen eines unbedeutenden
Kleingewerbes, sondern die Anlagen der so erfolgreichen
Messingindustrie,
deren Produkte für ganz Europa von Bedeutung waren.
In diesem Zusammenhang abschließend vielleicht noch
ein
Wort zum Wirkungsgrad, einem technischen Begriff, der das
Verhältnis
zwischen abgegebener, tatsächlich genutzter und eingebrachter
Energie angibt und den wir für die damalige Zeit mit nur
30 - 40% angenommen hatten. Aber genau dieser technisch objektiv
fassbare Wirkungsgrad erlaubt bezüglich Sinn oder
Sinnlosigkeit
eines Energieeinsatzes keinerlei Aussage, obschon diese - und
eigentlich nur diese - aus gesamtökologischer und -
ökonomischer
Sicht interessant wäre. Das oben angeführte Beispiel
aus der heutigen Zeit, das sich auf den Trend zum Zweit- und Drittwagen
bezieht, lässt ahnen, dass es durchaus möglich ist,
mit technischen Systemen selbst dann Energie zu vergeuden, wenn
diese Systeme hervorragende Wirkungsgrade aufweisen, die um
Größenordnungen
besser liegen als die Mühlräder der Kupfer- und
Reitmeister.
Und dann vielleicht noch eine Einordnung, eine Klassifizierung
aus einer etwas anderen Sichtweise: Die Wasserkraft war eine Art
regenerativer Energie, deren Höhe zwar einerseits durch das
jeweilige Wasserdargebot begrenzt wurde, die sich andererseits
jedoch - im Unterschied zu Erzlagerstätten beispielsweise
- zeitlich unbegrenzt nutzen ließ und bei deren Umsetzung
Langzeitspeicher überhaupt nicht involviert waren. Und mit
dem letzten Punkt, dem Fehlen von Speicherkapazität
nämlich,
hätten wir jetzt einen grundlegenden Unterschied zu einer
weiteren wichtigen Ressource, der Holzkohle, die, ähnlich
wie die Wasserkraft, von den Kupfer- und Reitmeistern
gleichermaßen
benötigt wurde.
Die Holzkohle
Auch bei der Holzkohle handelte es sich im Prinzip um einen
nachwachsenden
Rohstoff, dessen Ausgangsmaterial in den Buchenwaldbeständen
der nördlichen Eifel als riesiges Reservoir vorhanden war.
Man konnte also auf Grund der vorhandenen Bestände und
zunächst
völlig ungestraft sehr viel mehr Buchenholz pro Jahr zur
Holzkohlegewinnung schlagen, als im gleichen Zeitraum nachwachsen
konnte. Eisen- und Messinggewerbe waren also in der Lage, weiter
zu expandieren, obschon die dauerhaft verfügbare
Holzkohlekapazität
längst schon überschritten war, was irgendwann
natürlich
und unausweichlich höchst unangenehme Folgen haben musste;
Folgen, die sich zwar später erst zeigten, dann aber eben
doch sehr viel unangenehmer waren, als die Limitierung der Wasserkraft.
Letztere nämlich war schon ganz zu Anfang und ohne jeden
Zeitverzug spürbar gewesen, so dass dieser Standortfaktor
direkt, zu jedem Zeitpunkt und gleich von Anfang an
entwicklungssteuernd
eingehen konnte.

|
Holzkohle,
auch nach dem Verschwelen ist die
Holzstruktur noch gut zu erkennen.
Foto: F. Holtz |
Die Folgen des exzessiven Bucheneinschlages wurden um 1700
in aller Härte deutlich, wobei die höchst unangenehme
Art dieser Folgen generell typisch und kennzeichnend ist für
Systeme, deren Wirkungsmechanismen mit Speicherkapazitäten
und Zeitverzögerungen hinterlegt sind. Die Messing- sowie
Eisenherstellung und damit auch der Holzkohleverbrauch konnten
für eine gewisse Zeit ein Niveau erreichen, das die
Möglichkeiten
der Region deutlich überstieg, wobei die Diskrepanz zwischen
Bedarf und Verfügbarkeit anfänglich durch die
vorhandenen
riesigen Buchenwaldbestände überdeckt wurde.
Was dann folgte - eigentlich folgen musste - war eine
Strukturkrise,
wie man das heute zu bezeichnen pflegt, deren Verlauf und Ergebnis
ganz von dem Standortfaktor Holzkohle bestimmt wurde. Die
Kapazitäten
der holzkohleverbrauchenden Wirtschaftszweige mussten den
natürlichen
Gegebenheiten angepasst werden, sie mussten - um im heutigen Sprachbild
zu bleiben - gesundschrumpfen.
Es gab nie genug davon
Zur Einschätzung der damaligen Situation wären jetzt
noch zwei Dinge von Bedeutung: Zur Herstellung von einer
Gewichtseinheit
Holzkohle wurde ein Vielfaches an Buchenholz benötigt, und
dieses Buchenholz wuchs nur sehr langsam nach. Als Richtwert kann
man annehmen, dass zur Herstellung von 100 kg Holzkohle 400 kg
lufttrockenes und hierfür wiederum 500 kg frisches Buchenholz
benötigt wurden. Es ist fernerhin zu berücksichtigen,
dass die Waldflächen damals forstwirtschaftlich weniger
systematisch
genutzt wurden als dies heute der Fall ist. Während man heute
für einen Festmeter Buchenholz pro Jahr von einem
Flächenbedarf
von 2500 bis 2800 Quadratmeter ausgehen kann, dürfte dieser
Flächenbedarfswert zur damaligen Zeit deutlich höher,
vielleicht bei 4000 Quadratmeter gelegen haben (150 Festmeter
pro Hektar bei 60-jährigem Bestand). Wenn man also 500 kg
Buchenholz pro Jahr schlagen wollte (erforderliche Menge für
100 kg Holzkohle), so würde sich hierfür ein
Flächenbedarf
von ca. 2000 Quadratmeter ergeben, was der Größe von
zwei doch schon recht geräumigen Grundstücken
entspräche.
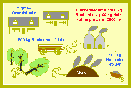
Skizze: F. Holtz
Der Verbrauch an Holzkohle pro Gewichtseinheit erschmolzenem
Metall war für die beiden Wirtschaftszweige stark
unterschiedlich
und lag bei der Eisenherstellung erheblich höher als bei
der Herstellung von Messing. Genau diese Tatsache war verantwortlich
dafür, dass die Anpassung der Produktionskapazitäten
an die dauerhaft verfügbare Holzkohlemenge sich fast
ausschließlich
zu Lasten der Reitmeister vollzog, die nach und nach aus dem Vichttal
verdrängt wurden.
Die Abwanderung der Reitmeister aus dem Vichttal weist ganz
eindeutig Parallelen zu der bereits besprochenen Situation im
früheren Aachen auf, nur, dass es diesmal nicht um
Wasserkraft,
sondern um Holzkohle ging, und dass der religiöse Aspekt
ganz einfach deshalb fehlte, weil auch die Reitmeister
überwiegend
protestantisch waren.
Wie stark die Kupfermeister bei dieser Auseinandersetzung im
Vorteil waren wird deutlich, wenn man sich den Holzkohlebedarf
und den damit verbundenen Verbrauch an Buchenholz etwas genauer
ansieht. Während zur Gewinnung von 100 kg Eisen 350 kg
Holzkohle
benötigt wurden, waren zur Herstellung der gleichen Menge
Messing nur etwa 50 kg Holzkohle erforderlich.
Gerade die Eisenöfen waren also richtige
Holzkohlenfresser,
wofür es natürlich auch einen Grund gab. Wurde
nämlich
beim Messingbrennen die Holzkohle lediglich als Reduktionsmittel
benötigt, wobei die eigentliche Beheizung
hauptsächlich
mittels Steinkohle erfolgte, so musste man bei der Eisenherstellung
die Holzkohle sowohl als Reduktionsmittel als auch zur Beheizung
einsetzen, wozu natürlich entsprechend
größere
Mengen erforderlich waren.

|
Reitwerk mit Hochofen,
Aquarell von Helmut Schreiber. |
Die Abhängigkeit von der nur langsam nachwachsenden
Holzkohle
verhinderte übrigens nicht nur in unserer Region noch sehr
lange eine großtechnische Massenproduktion von Eisen und
Stahl bis die Holzkohle durch die Verwendung von Koks abgelöst
werden konnte.
Der Verbrauch von Holzkohle und damit auch von Buchenholz bei
der Eisenherstellung sowie der hierfür erforderliche
Flächenbedarf
lassen sich verdeutlichen, wenn wir nochmals wieder ein relativ
großes Grundstück mit einer Fläche von 1000
Quadratmeter
als Ausgangsbasis annehmen. Diese mit Buchenwald bestandene
Fläche
würde bei den damals vorliegenden Nutzungsbedingungen
durchschnittlich
ca. 50 kg Holzkohle pro Jahr geliefert haben, die, bei
ausschließlicher
Verwendung zur Eisenherstellung, eine Gewinnung von etwas mehr
als 14 kg Eisen pro Jahr ermöglicht hätte. Dies
würde
einer Eisenmenge entsprechen, die gerade mal ausreichte, um jede
Woche ein einziges Tafelbesteck - bestehend aus einem
Esslöffel,
einer Gabel und einem Messer - herzustellen, wobei bei entsprechend
leichter Ausführung vielleicht auch noch jede Woche ein
Teelöffel
möglich gewesen wäre. Ein einziges Tafelbesteck pro
Woche ließ sich also mit dem Holzkohleertrag einer
Fläche
von 1000 Quadratmeter herstellen. Die Anschaffung einer kleineren
Ofenplatte, um noch ein weiteres Beispiel anzuführen,
bedeutete
zwangsläufigerweise die Inanspruchnahme der Fläche
eines
recht großen Grundstückes für ein ganzes
Jahr.
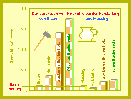
Skizze: F. Holtz
Natürlich könnte man jetzt auch fragen, wie
denn
wohl ein entsprechender Vergleichswert (Inanspruchnahme von
Fläche
pro Gewichtseinheit) bei der Steinkohle aussehen würde. Im
Prinzip wäre eine derartige Aussage sogar möglich,
denn
auch die Steinkohle ist vom Grundsatz her eine nachwachsende Ressource,
nur, dass wir nicht die Zeit haben, darauf zu warten. Unter dem
durchaus zutreffenden Gesichtspunkt, dass die Steinkohle vor langer,
langer Zeit tatsächlich einmal gewachsen ist und in nicht
absehbarer Zukunft wohl irgendwann und irgendwo wieder einmal
nachwachsen und abgelagert werden wird, ergibt sich beim Verbrauch
von Steinkohle eine Inanspruchnahme von Landfläche, die,
im Vergleich zur Holzkohle, exorbitant hoch ist.
In der Tat lässt sich die erste Bildungsstufe der
Inkohlung
als Vertorfung in unseren Mooren ständig beobachten, und
trotzdem waren zur Bildung abbauwürdiger
Steinkohleflöze
mehrere Jahrtausende erforderlich. Fernerhin gilt es zu bedenken,
dass die Voraussetzungen zur Entstehung von Steinkohle im Laufe
der erdgeschichtlichen Entwicklung recht selten waren, wobei wir
insgesamt über Zeiträume von einigen hundert
Millionen
Jahren reden. Während dieser fast schon unendlich langen
Zeit hat sich weltweit allerdings einiges an Vorräten
angesammelt.
Nur, wenn diese Vorräte einmal zur Neige gehen, werden die
daraus entstehenden Strukturprobleme nicht mehr so einfach
lösbar
sein, wie das damals noch im Vichttal bei der Holzkohlekrise
möglich
gewesen ist.
Warenwerte im Vergleich
Damals, zu Anfang des 18. Jahrhunderts, waren die Kupfermeister,
wie bereits erwähnt, in einer deutlich besseren Situation
als die Reitmeister, weil sie bei der Messingherstellung die Holzkohle
lediglich als Reduktionsmittel einsetzen mussten. Die Beheizung
der Öfen konnte mit Steinkohle erfolgen, was bei den
eisenschaffenden
Reitmeistern nicht möglich war. Die Gewichtsmenge der
produzierten
Metalle, die sich bei den Kupfermeistern und bei den Reitmeistern
durch Einsatz der jeweils gleichen Holzkohlenmenge ergaben, waren
somit stark unterschiedlich. Mit der gleichen Holzkohlemenge
ließ
sich (gewichtsbezogen) sieben mal mehr Messing als Eisen herstellen.
Damit aber nicht genug, Messing war auch das weitaus teurere Metall,
dessen Preis mehr als 10 mal höher lag als der des Eisens.
Der stark unterschiedliche Holzkohlebedarf pro Gewichtseinheit
produziertem Metall einerseits und die stark unterschiedlichen
Metallpreise andererseits führten dazu, dass die Warenwerte,
die sich beim Einsatz der gleichen Holzkohlemenge fertigen
ließen,
bei der Messingherstellung ungefähr 80 mal höher
waren,
als bei der Verhüttung und Verarbeitung von Eisen. Wenngleich
man bezüglich der Gewinnspannen und der gesamtwirtschaftlichen
Wertschöpfung nicht unbedingt von der gleichen
Verhältniszahl
auszugehen hat, ist es eigentlich einsichtig und nachvollziehbar,
dass die Holzkohle zunehmend dort eingesetzt wurde, wo sich mit
dem Einsatz dieser knapper werdenden Ressource ein möglichst
hoher Warenwert erzielen ließ.
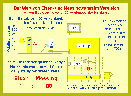
Skizze: F. Holtz
So einsichtig uns das auch heute erscheinen mag, die
Reitmeister
fanden diesen Anpassungsprozess verständlicherweise sehr
viel weniger einsichtig als vielmehr existenzbedrohend bzw.
existenzvernichtend.
Objektiv und mit sehr viel Abstand betrachtet war es nun aber
eigentlich so, dass den Reitmeistern aus gesamtwirtschaftlichen
Gründen eine Umsiedlung sehr viel eher zugemutet werden konnte
als den Kupfermeistern, denn Eisenerze ließen sich - auch
in der näheren Umgebung (Kalltal, Schleidener Tal usw.) -
sehr viel eher finden als der zur Messingherstellung erforderliche,
recht seltene Galmei. Die Abwanderung der Reitmeister aus dem
Vichttal vollzog sich nun aber natürlich nicht freiwillig
und aus der weisen Erkenntnis dieser Zusammenhänge, sondern
unter dem Druck der damals vorliegenden Sachzwänge. Es
handelte
sich also um einen Vorgang, den man heute als freies Spiel der
(marktwirtschaftlichen) Kräfte bezeichnen würde.
Wenngleich die Beteiligten diesen Ablauf wohl kaum als Spiel
aufgefasst haben dürften, waren die so genannten Spielregeln
klar: Bei der Messingherstellung war der Kostenfaktor Holzkohle
an den Gesamtproduktionskosten in sehr viel geringerem Maße
beteiligt und folglich von entsprechend geringerer Bedeutung als
bei der Eisengewinnung. Man konnte sich also im Messinggewerbe
die knapper und teurer werdende Holzkohle eher leisten und vereinnahmte
die benötigten Mengen gegebenenfalls über die Zahlung
entsprechend hoher Preise. Letzteres musste allerdings in nur
bescheidenem Maße praktiziert werden, da die Landesherren
aus fiskalischen Gründen (siehe Verhältnis der
Warenwerte
bei Einsatz gleicher Holzkohlemengen) die Messingindustrie
gegenüber
dem eisenschaffenden Gewerbe bevorzugten und den Kupfermeistern
nach entsprechenden Anträgen und Bittstellungen die Holzkohle
zu recht günstigen Preisen zuwiesen.
Und mit diesen Arrangements bezüglich der Ressourcen
-
wenn man es denn so nennen will - konnte sich die Messingindustrie
bis zur Hochblüte entwickeln und im 18 Jahrhundert
europäische
Monopolstellung erreichen. Während man, zusammenfassend
gesagt,
die Limitierung der dargebotenen Wasserkraft durch
großflächige
Besiedelung und Nutzung praktisch aller geeigneten Bachläufe
entschärfte, wurde das Problem der ebenfalls nur begrenzt
zur Verfügung stehenden Holzkohle dadurch gelöst,
dass
man die Konkurrenten, die Eisenhüttenleute nämlich,
die unverhältnismäßig hohe Holzkohlemengen
in
Anspruch nahmen, aus dem Tal verdrängte.
Auch Galmei wurde knapp
Bei dem dritten, dem eigentlich wichtigsten Grundstoff, dem Galmei, handelte
es sich,
wie allen Erzlagerstätten, um eine nicht-regenaretive
Ressource,
die sich selbstverständlich durch jedwede
Abbautätigkeit
reduzierte und verbrauchte. Und natürlich waren der
Entwicklung
der Messingindustrie hierdurch Grenzen vorgegeben, die irgendwann
ganz zwangsläufigerweise erreicht werden mussten.

In der Tat und wie nicht anders zu erwarten, ist diese Grenze
dann auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
spürbar
geworden, allerdings wurde die Verarmung der Erzmittel in den
Galmeifeldern von vielschichtigen, teils politischen, meist aber
technischen Entwicklungen begleitet und überprägt.
Letztlich
aber haben all diese Entwicklungen dazu geführt, dass die
Vormachtstellung des Stolberger Messinggewerbes zu Ende ging und
damit auch die Art der Messingherstellung, die für die Zeit
der Kupfermeister typisch war und die dem Stolberger Tal durch
seine Nähe zu den Galmeilagerstätten den
entscheidenden
Standortvorteil verschafft hatte.
So richtig begonnen haben die Schwierigkeiten mit dem englisch
- französischen Handelsvertrag, der 1786 abgeschlossen wurde,
und der dem Stolberger Messing in Frankreich hohe Schutzzölle
auferlegte, während englische Messingwaren ungehindert nach
Frankreich eingeführt werden konnten. Verschärft
wurde
die hierdurch ausgelöste Absatzkrise noch dadurch, dass die
Stolberger Galmeivorräte langsam zur Neige gingen, und man
zunehmend den teureren (allerdings auch qualitativ besseren) Altenberger
Galmei einsetzen
musste.
Man sollte sich allerdings davor hüten, diese
Absatzkrise
als Ursache für den Niedergang der Stolberger Messingindustrie
anzusehen, denn eine Veränderung der politischen Lage
hätte
eine nachhaltige Erholung der Stolberger Messingindustrie zur
Folge haben müssen, wenn die Schwierigkeiten wirklich nur
auf fehlende Absatzmärkte zurückzuführen
gewesen
wären. Tatsächlich hat es um die Wende vom 18. zum
19.
Jahrhundert (Franzosenzeit) für die Messingindustrie nochmals
eine kurze Blütezeit gegeben. Allerdings waren die
Möglichkeiten,
ausreichende Galmeivorkommen durch einfache Pingen-
und Packenbauweise
zu
erschließen, endgültig dahin. Die mit diesen
einfachen
Abbaumethoden erreichbaren Erzlager waren mittlerweile und nach
jahrhundertelanger Schürftätigkeit erschöpft.
Weiter