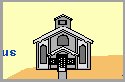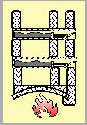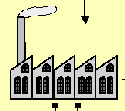Kurzübersicht
Frühindustrialisierung
Die einzige Möglichkeit, neue Erzmittel zu
erschließen,
bestand somit darin, die Grubenbaue zur Tiefe hin weiter vorzutreiben.
Der hierzu erforderliche Ausbau der Gruben markierte den Beginn
einer frühindustriellen
Epoche, die überleitete von der Betriebsform der als
Familienunternehmen
betriebenen Kupferhöfe zu Großunternehmen mit dem
Charakter
von Beteiligungsgesellschaften, die, im Gegensatz zu
mittelständischen
Privatunternehmen, in der Lage waren, den nunmehr erforderlichen
riesigen Investitionsaufwand bereitzustellen.
Das Vordringen in größere Tiefen war zwar
naheliegend,
aber eben doch nicht ganz so einfach. Naheliegend deshalb,
- weil im oberflächennahen Bereich
äußerst ergiebige Erzmittel angestanden hatten und
.
- weil man, gestützt auf ein zunehmend besseres
Verständnis der Bildungsmechanismen, tiefer liegende
Primärerz-Lagerstätten vermuten und erwarten konnte.
Die im Prinzip berechtigten Hoffnungen auf tiefer lagernde, reiche
Erzmittel haben sich allerdings nicht immer erfüllt. Im
Bereich
der Galmeifelder Büsbacherberg,
Brockenberg
oder
Herrenberg
beispielsweise
mussten die im Ausbau befindlichen Gruben mit erheblichen finanziellen
Verlusten aufgegeben werden, da sich die erschlossenen Vorkommen
durchaus nicht als abbauwürdig herausstellten. In anderen
Grubenfeldern hingegen (z.B. Diepenlinchen
oder Breinigerberg)
hatte man mit dieser Strategie durchschlagenden Erfolg und
stieß
auf Erzvorräte, die Basis werden sollten für einen
ganz
neuen Industriezweig, der seinerseits wiederum andere Industrien
entscheidend beeinflussen sollte.

|
Erzgrube Breinigerberg,
Lithographie von Adrien Chanelle. |
Aber genau diese Ungewissheit bei der Erschließung
neuer
und tieferer Gruben war die Ursache dafür, dass man in allen
Abbaugebieten häufig allegorische (gleichnishafte) Grubennamen
verwendete (z.B. 'Gute Hoffnung', 'Segen Gottes' oder
ähnliches).
Hierfür gibt es auch im Stolberger Raum ein gutes Beispiel:
nämlich den ebenfalls allegorisierenden Grubennamen "Zufriedenheit".
Andererseits jedoch war, wie bereits erwähnt, der
Tiefenausbau
eben auch nicht ganz so einfach, da die zufließenden
Grubenwässer
einen tieferen Abbau zunächst verhinderten, was auch der
Hauptgrund dafür war, dass man sich über Jahrhunderte
mit Abbautiefen von 40 m und weniger begnügt hatte, bzw.
hatte begnügen müssen. Was also war passiert, wieso
konnte man jetzt plötzlich auf breiter Front (Diepenlinchen,
Breinigerberg, Büsbach usw.) Grubenbaue anlegen, die sich
zur Tiefe hin bis weit unterhalb des Grundwasserspiegels erstreckten?
Hierfür gab es nun nicht nur einen, sondern eigentlich gleich
mehrere Gründe.
Zunächst einmal waren um die Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert
(Franzosenzeit) die stark zersplitterten Abbaufelder zu
Großkonzessionen
zusammengelegt worden. Hierdurch erst wurde großtechnischer
Abbau überhaupt praktikabel, da sich die hierfür
erforderlichen
Investitionen nur bei entsprechend großflächig
angelegten
Abbaufeldern lohnen konnten.
Der zweite Grund bezog sich auf die Lösung der
bereits
erwähnten Wasserzuflüsse. Da von der Vichtbachsohle
ausgehend Wasserhaltungsstollen vorgetrieben wurden, war die
Entwässerung
der Grubenteile, die oberhalb des Niveaus der Talsenke lagen,
eigentlich kaum ein Problem, sieht man von dem erforderlichen
Investitionsaufwand einmal ab. Das eigentliche Problem bestand
darin, die zufließenden Grubenwässer aus den tiefer
liegenden Bauen abzupumpen. Die hierzu erforderlichen Energiemengen
konnten letztlich nur durch den Einsatz von Dampfmaschinen
bereitgestellt
werden, die mittlerweile als relativ ausgereifte, betriebssichere
Konstruktionen zur Verfügung standen. Mit den in
früherer
Zeit üblichen Pferdegöpeln jedenfalls hätte
man
überhaupt keine Chance gehabt, der Wassermassen Herr zu werden.
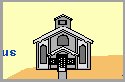
Skizze: F. Holtz
Dampfmaschinen jedoch, die eigentlich überall und auf
allen Gebieten die so genannte industrielle Revolution
auslösten,
diese Dampfmaschinen brauchten natürlich Kohle; Steinkohle,
die bei den erforderlichen Antriebsleistungen und den relativ
schlechten Wirkungsgraden früherer Konstruktionen in riesigen
Mengen herangeschafft werden musste. Bei der Erzgrube Diepenlinchen
beispielsweise überstieg der zum Betrieb der Wasserhaltung
erforderliche Bedarf an Kohle (Gewichtseinheiten) die
Erzfördermengen
zum Teil ganz erheblich.
Erze und Kohle
Und diese so dringend benötigte Steinkohle lag nur wenige
Kilometer von den Erzlagerstätten entfernt, nämlich
im Bereich Birkengang,
Atsch
und Münsterbusch.
Hier wird nun ganz besonders deutlich, warum in und um Stolberg
eine bedeutende Industrieregion entstehen konnte, deren Entwicklung
lückenlos anknüpfte an die Zeit der Kupfermeister und
durch die besonderen natürlichen Gegebenheiten
ermöglicht
wurde. Während die Erzlagerstätten bereits
über
Jahrhunderte die Entwicklung geprägt hatten, wurde nunmehr
die Lagerstättenkombination - Erze im Süden und Kohle
im Norden - zum bestimmenden Wirtschafts- und Standortfaktor.
Erze und Kohle, genau diese Konstellation war entscheidend für
den gewaltigen Erfolg unserer Wirtschaftsregion in
frühindustrieller
Zeit.

|
Steinkohlegrube Atsch
Quelle:
Kohlhaas (1965) |
Es ist natürlich immer recht problematisch, den
geschichtlichen
Ablauf unter der Prämisse "was wäre gewesen, wenn..."
interpretieren zu wollen. Aber es ist durchaus anzunehmen, dass
der Galmei, der durch den zwischenzeitlich vorgenommenen Grubenausbau
wieder zugänglich geworden war, eine neue Blütezeit
der Stolberger Messingindustrie hätte einleiten
können,
wenn nicht zeitlich parallel eine neue Entwicklung auf dem Gebiet
der Metallurgie stattgefunden hätte, die gerade für
Stolberg von entscheidender Bedeutung werden sollte.
Zink in Muffeln
Im ausgehenden 18. und im beginnenden 19. Jahrhundert waren von
William Champion (Bristol/England), von Christian Ruberg (Schlesien)
und von Daniel Dony (Lüttich) gleichzeitig und
unabhängig
voneinander Verfahren zur kommerziellen Zinkherstellung entwickelt
worden.
Eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Herstellung
von Zink hatte darin bestanden, dass man dieses Metall nicht aus
seinen Erzen ausschmelzen konnte, wie dies bei den meisten anderen
Metallen der Fall war. Die erforderliche Verhüttungstemperatur
lag deutlich höher als die Siedetemperatur, so dass nicht
flüssiges Zink, sondern Zinkdämpfe entstanden, die
sich
überdies sofort mit dem Luftsauerstoff zu Zinkoyxd verbanden.
Das Prinzip der neuen, aus England, Belgien und Schlesien kommenden
Verfahren beruhte darauf, das Erz zusammen mit einem Reduktionsmittel
zur Bindung des Sauerstoffes (meist Anthrazit oder Koks) stark
zu erhitzen und die Zinkdämpfe unter Luftabschluss zu
kondensieren.
Dies geschah in Muffeln, die aus feuerfestem Tonmaterial hergestellt
waren und die von den heißen Flammgasen der so genannten
Muffelöfen umströmt wurden.
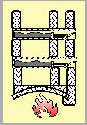
Skizze: F. Holtz
Der größere Teil einer solchen Muffel
diente der
Aufnahme des Erzes und des Reduktionsmittels. An einer Seite war
die Muffel mit einem röhrenförmigen Fortsatz
versehen,
der aus dem eigentlichen Feuerraum herausragte und auch Vorlage
genannt wurde.

Zinkschmelzer
beim Einsetzen
einer Vorlage
|

Vorlage,
Museum Zinkhütter Hof.
Foto: F. Holtz
|
Nach dem Aufheizen des gefüllten Muffelteils auf weit
über 1000oC bildeten sich hier
Zinkdämpfe
und Kohlenmonoxyd-Gase, welche sich beide in der
röhrenförmigen
Vorlage sammelten. Hierbei kondensierten die Zinkdämpfe in
der relativ kühl gehaltenen Vorlage zu flüssigem
Zink,
während die Kohlenmonoxyd-Gase den Luftsauerstoff fernhielten.
Überschüssiges Kohlenmonoxyd konnte durch die
Röhrenöffnung
der Vorlage ins Freie abströmen u. wurde hier durch Abfackeln
unschädlich gemacht (Aufoxydieren des Kohlenmonoxydes zu
Kohlendioxyd).
Das Grundprinzip dieses Verfahrens, das auch Zinkdestillation
genannt wird, mag weiten Kreisen (verbotenerweise) recht
geläufig
sein. Es funktioniert nämlich ähnlich wie das nach
dem
Krieg sporadisch betriebene Brennen von Schnaps, nur dass hierbei
natürlich nicht Zink, sondern 'Knolly Brandy' oder
ähnliches
gewonnen wurde.

Dieses technisch sehr aufwendige Verfahren kam in Stolberg
schon recht früh zum Einsatz. Dem Vernehmen nach muss der
erste Versuch allerdings wohl auch prompt daneben gegangen sein.
Bereits 1808 soll in Stolberg ein Reduktionsofen gebaut worden
sein, der jedoch auf Grund technischer Mängel nicht
funktionsfähig
war. Wo dieser Ofen gestanden haben soll und wer dessen Besitzer
war, ist nicht mehr bekannt.
Man muss allerdings den Stolbergern zugestehen, dass gerade
die Zinkherstellung ein technologisches Abenteuer gewesen ist,
das technische Lösungen verlangte, die man heute als HighTech
bezeichnen würde. Und derartige Lösungen sind dann
später
in Stolberg auch erarbeitet worden; Lösungen, die teilweise
Technologie-Impulse von weltweiter Bedeutung gegeben haben. Hierzu
war natürlich auch Innovationspotential erforderlich,
ebenfalls
ein Schlagwort aus der heutigen Zeit. Wenngleich dieser Ausdruck
damals noch nicht existierte, war das, was man darunter versteht,
im vorigen Jahrhundert in unserer Region durchaus vorhanden und
ergab sich aus dem industriegeschichtlichen Umfeld der
Messingherstellung,
die ja damals bereits auf eine traditionsreiche Entwicklung
zurückblicken
konnte.
Die erste, richtig funktionierende Zinkhütte
Stolbergs
ging dann 1819 in Betrieb. Sie war von dem Kupfermeister Matthias
Leonhard Schleicher durch Umbau seines Messingwerkes in der Velau
gegründet
worden. Auch hier wird wiederum die Tatsache deutlich, dass die
Zinkherstellung in Stolberg als Weiterführung einer
traditionell
erfolgreichen Buntmetallindustrie gesehen werden muss, die im
18. Jahrhundert in Hochblüte stand, jedoch gegen Ende des
19. Jahrhunderts hauptsächlich auf Grund der knapper werdenden
Erzbasis (Galmei) zunehmend in Schwierigkeiten geraten war.
Sehr viel einschneidender als der Mangel an erreichbaren
Galmeivorräten
erwies sich für den Messingstandort Stolberg die Tatsache,
dass jetzt plötzlich metallisches Zink in nahezu beliebigen
Mengen zur Verfügung stand, und dass man dieses Zink anstelle
des sehr viel unhandlicheren Galmeis bei der Messingherstellung
einsetzen konnte. Es war auch - völlig anders als es noch
beim Galmei der Fall gewesen war - überhaupt kein Problem
mehr, das Zink zu den Kupferstandorten zu transportieren, um die
Messinglegierung dort herzustellen.
Jahrhundertelang hatte Stolberg davon profitiert, dass man
Messing am wirtschaftlichsten dort herstellen konnte, wo der
unentbehrliche
Rohstoff Galmei in nächster Nähe gefördert
wurde.
Und genau dieser Standortvorteil war durch die Verfügbarkeit
von metallischem Zink jetzt plötzlich dahin, wodurch sich
das Messinggewerbe einem schmerzhaften Strukturwandel
gegenüber
sah. Aus einer Vielzahl relativ kleiner Produktionsstätten,
die meist den Kupferhöfen als Betriebshütten
angegliedert
waren, entwickelten sich einige wenige Großbetriebe, die
auch in Stolberg dazu übergingen, zur Herstellung von Messing
metallisches Zink einzusetzen.
Damit allerdings ist unsere Geschichte von den
lagerstätten-bedingten
Standortvorteilen noch lange nicht zu Ende erzählt, denn
unsere Erzlagerstätten, die für die Messingindustrie
zwar nicht mehr relevant waren, bildeten in Verbindung mit den
Kohlevorkommen jetzt die entscheidende Grundlage für eine
prosperiernde Zinkindustrie.
Das Problem mit der Blende
Zuvor jedoch musste noch ein grundsätzliches Problem
gelöst
werden. In den neu ausgebauten Gruben wechselte der Erztyp
überall
von Galmei nach Schalenblende,
was ursächlich durch die Bildungsmechanismen
begründet
war. Der Galmei war, wie bereits erklärt, durch Verwitterung
bzw. Umsetzung (Metasomatose)
aus der Schalenblende entstanden, und dieser Oxydationsvorgang
hatte nur in den oberflächen-nahen Bereichen wirksam werden
können. Somit traf man in den immer tiefer bauenden Gruben
fast nur noch auf Schalenblende (auch Zinkblende
genannt) und eben nicht mehr auf Galmei. Wie man sich
möglicherweise
erinnern wird, hatte dieses Erz (der Name 'Blende' weist schon
darauf hin) seit Alters her einen schlechten Ruf, da man es einerseits
zum Messingbrennen nicht verwenden konnte und es sich andererseits
allen Verhüttungsversuchen widersetzt hatte.

|
Zink- bzw. Schalenblende |
Nachdem aber jetzt die Methode der Zinkverhüttung
bekannt
war, war eigentlich auch klar, was mit der Zinkblende passieren
musste, bevor sie im Reduktionsofen eingesetzt werden konnte.
Man musste sie nämlich in ganz ähnlicher Weise rösten,
wie es bei der Verhüttung des Bleiglanzes seit jeher
gängige
Praxis gewesen war. Hierdurch wurde die Zinkblende (Zinksulfid)
zu Zinkoxyd umgewandelt.
Der Apotheker Friedrich Wilhelm Hasenclever,
der 1850 die Waldmeisterhütte
gegründet hatte und 2 Jahre später
Mitbegründer
und Teilhaber der Chemischen Fabriken "Rhenania"
wurde, entwickelte um 1850 einen Röstofen, dessen Konstruktion
auf die Röstung der Blende zugeschnitten war, und der die
freiwerdenden Röstgase zur Herstellung von
Schwefelsäure
nutzbar machen sollte.
Das aus der Blende gewonnene Zinkoxyd hätte man
übrigens
durchaus auch zur Messingherstellung nach dem alten Galmeiverfahren
verwenden können. Aber dieses Verfahren war mittlerweile
durch die technische Entwicklung abgelöst und bedeutungslos
geworden. Man könnte sich allerdings fragen, warum der an
sich bekannten Röstprozess nicht schon viel früher,
nämlich zur Zeit der Kupfermeister eingesetzt worden ist,
um die Zinkblende so aufzubereiten, dass sie für das damals
übliche Galmeiverfahren
verwertbar wurde.
Die Antwort darauf ist deshalb sehr naheliegend, weil zum
Rösten
der Zinkblende keinerlei Veranlassung oder Notwendigkeit bestand.
Bei den damaligen Abbaumethoden, die sich auf Pingen- und
Packenbauweise
von nur geringer Schürftiefe beschränkten, blieb die
Zink- bzw. Schalenblende im Prinzip unzugänglich und trat
- wenn überhaupt - nur als kümmerliche Relikte im
bereits
umgesetzten
Galmei
auf. Wäre Zinkblende zu dieser Zeit schon in wirtschaftlich
interessanten Mengen beim Abbau angefallen, so ist mit einiger
Sicherheit davon auszugehen, dass man die bestens bekannte Methode
der Erzröstung irgendwann auch in Verbindung mit der
Zinkblende gesucht und gefunden hätte. Aber so wie die
Entwicklung gelaufen ist, blieb die Förderung der
Schalenblende,
deren Röstung und Verwendung als Zinkerz der
frühindustriellen
Epoche vorbehalten, als die Zeit der Kupfermeister und des
Messingbrennens
bereits zu Ende gegangen war.
Schon die Hasenclever-Öfen der ersten Generation, die
bereits eigens zum Rösten der Zinkblende ausgelegt waren,
lieferten bezüglich der Aufbereitung der Blende (Umwandlung
nach Zinkoxyd) recht gute Ergebnisse, allerdings konnte das eigentliche
Ziel Hasenclevers, nämlich die Nutzung der Röstgase
zur Herstellung von Schwefelsäure,
zunächst nicht erreicht werden.
Warum aber, so könnte man fragen, maß man
der Gewinnung
von Schwefelsäure eine so hohe Bedeutung zu. Zunächst
müsste diese Frage mit dem Hinweis beantwortet werden, dass
man die Schwefelsäure zur Herstellung von Soda
benötigte, wobei dann allerdings wiederum ein gewisser
Erklärungsbedarf
verbleibt, wieso denn die Soda so wichtig und begehrt gewesen
ist. Hierzu jedoch müsste man etwas weiter ausholen und sich
vielleicht einmal vergegenwärtigen, was damals nicht nur
in Stolberg, sondern überhaupt in der Welt los war.
Pottasche und Soda
Die bereits erwähnte Dampfmaschine und der allgemeine Trend
zur Mechanisierung hatte insbesondere in der Textilindustrie eine
stürmische Entwicklung eingeleitet. Man denke nur an die
mechanischen Webstühle, mit deren Hilfe jetzt
plötzlich
ungeahnte Mengen billiger Tuche produziert werden konnten. Entsprechend
groß wurden somit auch die Mengen der Rohwolle, die
vorbehandelt
werden mussten. In den Wäschereien und Bleichereien
benötigte
man hierzu eine Substanz, die in Pflanzenasche (vorzugsweise Holzasche)
enthalten war und Pottasche
genannt wurde. Die Pottasche bestand aus Kaliumkarbonat und konnte
mittels Wasser aus der Pflanzenasche ausgewaschen werden. Die
hierzu erforderlichen Gefäße (Pötte) haben
dieser
Substanz dann auch ihren Namen gegeben. Je nach Anwendungszweck
fand entweder die Asche direkt, oder das ausgewaschene Kaliumkarbonat
Verwendung.
Die Herstellung der Pottasche oder der Holzasche
überhaupt
wäre an sich kein Problem gewesen, wenn man Holz in
hinreichender
Menge zur Verfügung gehabt hätte. Die Situation
bezüglich
der Pottasche war ganz ähnlich wie - oder eigentlich noch
viel schlimmer als - bei der Gewinnung von Holzkohle. Holz war
nämlich erstens mittlerweile europaweit knapp geworden, was
nicht zuletzt daran lag, dass man zweitens zur Herstellung von
Holzasche noch weit mehr Holz einsetzen musste, als dies bei der
Verkohlung in Holzkohlemeilern der Fall war.
Man muss sich einmal vorstellen, wozu die Wälder
damals
herhalten mussten: sie hatten Brennholz, Bauholz, Grubenholz,
Kohlholz, Holz für den Schiffbau und dann auch noch Holz
für die Pottaschegewinnung zu liefern. Und bei der Gewinnung
von Holzasche war der Holzverbrauch nun ganz besonders hoch. Lediglich
3 kg Holzasche ließen sich bei der Verbrennung von 1 Tonne
Buchenholz oder von 2 Tonnen Eichenholz oder von gar 4 Tonnen
Pappelholz gewinnen. Bei diesen Relationen lässt sich leicht
vorstellen, dass Holz knapp und teuer wurde.
Eine gewisse kurzzeitige Entspannung der Situation ergab sich,
als man herausgefunden hatte und dazu überging, auch die
Asche von Seepflanzen zu verwenden. Der hierin enthaltene Wirkstoff
war Natriumkarbonat, auch Soda genannt. Das damals bekannteste
und wohl auch beste Produkt war die spanische Barilla-Soda, die
sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Exportschlager
entwickelte.
Eine gewisse Rolle spielte auch die Soda aus natürlichen
Lagerstätten, die beispielsweise in Ägypten in
bescheidenem
Maße abgebaut wurden. Durch die Verwendung der
Seepflanzenasche
wurde das Problem zwar etwas entschärft, aber nicht
grundsätzlich
gelöst, da auch für andere Produktionsprozesse Soda
in großen Mengen benötigt wurde. Neben der
Glasindustrie
wäre hier noch die Herstellung von Seife und Waschmittel
zu nennen.
Bezüglich der Textilindustrie wäre noch zu
vermerken,
dass zur Deckung des Textilbedarfs in zunehmendem Maße
Baumwolle
Verwendung fand. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts verdoppelte
sich der Einsatz von Baumwolle innerhalb eines Zeitraumes von
knapp 20 Jahren bei einem bereits beträchtlichen
Ausgangsniveau
(alleine England verarbeitete 1810 etwa 60.000 Tonnen Baumwolle).
Der steigende Baumwollanteil machte nun wiederum den Einsatz
größerer
Sodamengen erforderlich, weil man zunächst das Samenfett
auswaschen und dann die Fasern noch bleichen musste, damit der
schmutzig-graue Farbton verschwand und ein
gleichmäßiges
Färben oder Bedrucken möglich wurde.
Die Soda und Pottasche waren also sozusagen
Schlüsselsubstanzen,
da die Entwicklung ganzer Industriezweige (Textil, Glas und
Waschmittel)
ganz entscheidend von der Verfügbarkeit der Soda, der
Pottasche
oder ganz allgemein von dem knappen und teuren Grundstoff Pflanzenasche
abhing. Somit begann im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts die
Suche nach einem Verfahren zur Herstellung künstlicher,
synthetischer
Soda, denn die Produkte, zu deren Herstellung Pflanzenasche
erforderlich
war (insbesondere Seife, Waschmittel und Glas), zählten auf
Grund der hohen Kosten einerseits zu den Luxusgütern,
ließen
andererseits aber riesige Absatzmärkte erwarten, wenn man
sie in entsprechenden Mengen billiger hätte produzieren
können.
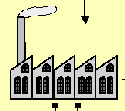
Skizze: F. Holtz
Der Durchbruch gelang noch vor Ablauf des 18. Jahrhunderts.
Nicolas Leblanc
und sein
Assistent Dize' hatten nach mehrjährigen Versuchsreihen einen
Weg zur synthetischen Sodaherstellung gefunden: Beim Zusammenschmelzen
von
- Natriumsulfat (Glaubersalz),
- Kohle und
- Kalziumkarbonat
bildete sich Soda. Natriumsulfat konnte aus Steinsalz und
Schwefelsäure
gewonnen werden. Und diese Schwefelsäure wiederum
ließ
sich recht einfach aus den Röstgasen herstellen, die beim
Abrösten der Zinkblende entstanden, was natürlich
voraussetzte,
dass man diese Röstgase auffangen konnte. Die beiden anderen
Ausgangsstoffe, die man zur Sodaherstellung benötigte, waren
in unserer Region reichlich vorhanden: Kohle nämlich und
Kalziumkarbonat, wobei dieses Kalziumkarbonat nichts anderes war,
als unser bestens bekannter, oft schon erwähnter Kalkstein,
- der die Erzbildung und Erzablagerung in erdgeschichtlicher
Vorzeit bereits beeinflusst hatte,
.
- der auf Grund seiner weiträumigen Erstreckung und
der trockenen Ausbildung der darüberliegenden Böden
für die vor- und frühgeschichtliche Besiedelung von
maßgeblicher Bedeutung gewesen war und
.
- der auch jetzt wieder zur Zeit der
Frühindustrialisierung als Einsatzstoff bei der
Sodaherstellung eine tragende Rolle spielen sollte.
Die Bemühungen Hasenclevers, einen Röstofen
zu entwickeln,
der in der Lage war, das freiwerdende Schwefeldioxydgas aufzufangen,
müssen vor dem Hintergrund
- der mittlerweile bekannten technischen
Möglichkeiten der Glaubersalzherstellung und der ebenfalls
bekannten Verfahren zur Herstellung von Schwefelsäure aus
Schwefeldioxyd,
.
- der geologisch- mineralogischen Eigenarten unserer Region
(Lagerstättenkonstellation von Kalkstein, Erze, Kohle),
.
- einer enormen Schädigung der Umwelt durch die
Röstgase sowie der daraus folgenden Schwierigkeiten der
Zinkindustrie bezüglich zu leistender
Entschädigungszahlungen und
.
- nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund eines weltweit
steigenden Sodabedarfs mit ebenfalls steigender Nachfrage in den
unmittelbar benachbarten Textil-, Glas- und Waschmittelindustrien.
gesehen werden.
Nachdem das Auffangen der Röstgase zwischen 1850 und
1855
zunehmend besser gelang, konnte man mit der Herstellung von Soda
beginnen, wobei lediglich das Steinsalz als Zuschlagstoff in unserer
Region nicht vorhanden war und herantransportiert werden musste.
Technologische Abhängigkeiten
Die Bedeutung der Standortfaktoren Kalkstein und Erze lässt
sich, wenn auch für den heutigen Beobachter vielleicht
überraschenderweise,
aber dennoch mit Fug und Recht ausdehnen auf weite Bereiche der
Frühindustrialisierung.
Unsere Erzvorkommen haben folglich nicht nur die hiesige
Metallindustrie
geprägt, sondern über das Bindeglied
Schwefelsäure
ebenfalls direkte und entscheidende Impulse für die
Entwicklung
der Großchemie gegeben und hierüber auch die
Entwicklung
von Textil-, Waschmittel- und Glasindustrie durchaus signifikant
beeinflusst. Die aus der Existenz, der Förderung,
Aufbereitung,
Verhüttung und Verarbeitung unserer Erze resultierende
Belastung
der heimischen Region ist sicherlich schon immer ein Problem gewesen
und wird im Hinblick auf Schwermetallkontaminierung und
bezüglich
geeigneter Vorsichtsmaßnahmen auch zukünftig noch
ernsthaft
zu diskutieren sein. Das Problem Schwermetallbelastung wird uns
also durchaus schon noch für einige Zeit
beschäftigen.
Grundsätzlich verdammen aber sollte man sie trotzdem nicht,
die Erze unserer Region, denn die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung
unseres Raumes wäre ganz sicher weniger günstig,
wahrscheinlich
sogar sehr viel weniger günstig verlaufen, hätte man
eben diese Erze nicht gehabt.
Die Epoche der Frühindustrialisierung war ganz
allgemein
und insbesondere auch in Stolberg gekennzeichnet durch gegenseitige
Abhängigkeiten (Interdependenzen) und Verflechtungen zwischen
den einzelnen Industriezweigen; Interdependenzen und Verflechtungen,
die vorwiegend und ursächlich technologischer Natur waren.
Das ist am Beispiel der Stolberger Zinkindustrie recht deutlich
darstellbar. Die bei der Aufbereitung der Zinkblende als Abfallprodukt
anfallenden Röstgase dienten einem anderen Industriezweig,
in diesem Fall der Sodachemie, als Grundstoff. Dieses Prinzip
lässt sich durchaus generalisieren, denn vergleichbare
Verhältnisse
ergaben sich beispielsweise auch bei den Kokereien, wo das anfangs
lästige Abfallprodukt Teer sehr bald zum begehrten Grundstoff
für die Teerchemie wurde, deren Produkte wiederum in so
unterschiedlichen
Bereichen Verwendung fanden, wie beispielsweise Farbstoffherstellung
oder Pharmaindustrie.
Manchmal scheint es sogar Situationen gegeben zu haben, die
das Abfallprodukt Teer ganz offensichtlich aus Gründen der
Nachfrage zum Hauptprodukt avancieren ließen. Zumindest
tendenziell und sporadisch scheint es in Stolberg auch zu einer
derartigen Rollenvertauschung zwischen Haupt- und 'Abfall'-Produkt
gekommen zu sein. Manchmal hat man nämlich hier bei uns neben
der Zinkblende auch Markasit
(eine Eisen-Schwefelverbindung) geröstet, und das nicht etwa
um verwertbares Eisenerz zu erhalten, sondern um die Nachfrage
nach Schwefelsäure abdecken zu können. Die
vielfältigen
technologischen Verflechtungen und die daraus resultierende
Komplexität
lassen es nun allerdings geboten erscheinen, die Epoche der
Industrialisierung
nicht mehr chronologisch, sondern entsprechend der einzelnen
Teilgebiete
abzuhandeln. Bevor wir aber den Gesamtkomplex zerpflücken,
häppchenweise aufarbeiten sozusagen, lassen sich noch einige
allgemeingültige Einflüsse zeigen, die sich aus der
geographischen Lagerstättenverteilung von Erze und Kohle
ergaben.
Möglicherweise ist es bereits aufgefallen, dass die
Standorte
der einzelnen Zinkhütten mit der Lage der Erzvorkommen nicht
so recht zusammenpassten. Dafür jedoch lagen die
Zinkhütten
ausnahmslos in einem Bereich, wo Steinkohle verfügbar war:
- Münsterbusch-James-Grube
- Atsch-'Et Küllche'
- Birkengang-Eschweiler Kohlberg.
Das hatte natürlich einen guten Grund. Kohle
nämlich
war sowohl für die Zinkverhüttung als auch
für
die Erzförderung (dampfbetriebene Wasserhaltung)
erforderlich. Das Transportwesen konnte somit in Form eines
Pendelverkehrs
recht effektiv organisiert werden. Auf dem Weg von den Erzgruben
zu den Hütten wurde Erz transportiert, während auf
dem
Rückweg von den Hütten, die sich
ausschließlich
im Bereich der Kohlengruben befanden, zu den Erzgruben Kohle
mitgenommen
werden konnte, um den dortigen Energiebedarf abzudecken.
Auch andere Industriezweige, die mit hohem Energieaufwand
arbeiteten,
siedelten sich im Bereich des Kohlegürtels an, der im Norden
Stolbergs vom Eschweiler
Kohlberg über Atsch
nach Münsterbusch
verlief. Neben den Zinkhütten waren dies insbesondere die
Glashütten und die Sodaindustrie. Die enge örtliche
Anlehnung der Zinkhütten und auch der anderen Industriezweige
an die Kohlengruben kann im Bereich Münsterbusch in geradezu
beispielhafter Weise und für einen doch schon recht
frühen
Zeitpunkt der Industrialisierung verdeutlicht werden. Der Lageplan
aus dem Jahr 1838 zeigt sowohl die Zinkhütte
als auch Glashütten in direkter Nachbarschaft zu der James-Grube,
wobei Zinkhütte
und Kohlengrube sich im Besitz der gleichen Betreibergesellschaft
befanden. Kurze Zeit später, im Jahr 1846, gesellte sich
dann noch in unmittelbarer Nachbarschaft eine Blei-
und Silberhütte hinzu.

Es ist natürlich Zufall, aber die Industriestandorte
im
Bereich des Kohlegürtels erwiesen sich auch dann noch als
günstig, nachdem die hier abgebaute Kohle knapp und teuer
wurde. Die 1841 erbaute 'Rheinische Eisenbahn' schuf die
Voraussetzungen,
billige auswärtige Kohle einzusetzen, und der Steckenverlauf
dieser Bahn erlaubte eine relativ einfache verkehrstechnische
Anbindung der neu entstandenen Industrieansiedlungen. In den 80-er
Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die bedeutenden
Industrieunternehmen
durch Anschlussgleise direkt mit der Hauptbahn (Aachen - Köln)
verbunden.
Kommen wir nun jedoch wieder zurück zu den Erzen, die
vor der Weiterverarbeitung noch aufbereitet, nämlich
geröstet
werden mussten. Und mit diesem Röstprozess werden wir uns
als nächstes befassen, bevor wir mit der
Zinkverhüttung
und schlussendlich der Herstellung von Soda fortfahren.
Weiter